Europäische Union (EU)
Veröffentlicht November 23rd, 2021 - von: Christian Jakob
Basisdaten und kurze Charakterisierung
Die 1993 gegründete EU mit Sitz in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist der größte Staatenbund und der größte Wirtschaftsraum der Erde. Sie besteht aktuell aus 27 Staaten und hat eine Fläche von rund 4,1 Millionen km². 23 der 27 Staaten sind Teil des Schengener Abkommens, innerhalb dessen es keine Binnengrenzkontrollen mehr gibt und zu dem die drei Nicht-EU-Staaten Norwegen, Island und Schweiz gehören. Seit dem Ausscheiden Großbritanniens hat die EU rund 447 Millionen Einwohner*innen.
Die EU hat seit Februar 2020 Außengrenzen mit einer Länge von rund 14.800 Kilometern. Rund 18 Kilometer sind dabei Festlandgrenzen mit Afrika, in den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Für die irreguläre Migration von Bedeutung sind zudem rund 932km Grenze mit Bosnien (Kroatien); 446km Grenze mit der Türkei (Bulgarien und Griechenland) sowie 1.260km Grenze mit der Ukraine (Rumänien, Polen, Ungarn, Slowakei).[1]
Regierung, Politisches System und Ökonomie
Regierung und Politisches System
Im Laufe der Jahrzehnte haben die EU-Staaten einen Teil ihrer politischen Kompetenzen an die EU abgegeben. Gleichwohl bestimmen die Nationalstaaten die EU-Politik nach wie vor maßgeblich.
Die 27 Regierungschefs bilden den Rat der EU, der die allgemeinen politischen Prioritäten setzt. Mehrmals pro Jahr kommen sie zu sogenannten EU-Gipfeln zusammen. Inhaltlich ist der Rat die höchste Instanz der Europäischen Union. Die Mitglieder diskutieren Grundsätze und Leitlinien der europäischen Zusammenarbeit – etwa die weitere europäische Integration oder außen- und sicherheitspolitische Fragen. Ihre Vorgaben sind entscheidend für die Arbeit der Kommission.
Parallel gibt es ein direkt gewähltes EU-Parlament mit Doppelsitz in Brüssel und Straßburg (Frankreich) mit derzeit 705 Abgeordneten aus allen 27 Staaten. Das Parlament wird alle fünf Jahre von den wahlberechtigten Bürger*innen der Mitgliedstaaten direkt gewählt. Es ist zusammen mit dem Ministerrat gesetzgebende Gewalt der Europäischen Union.
Im Ministerrat sind die nationalen Fachminister*innen vertreten. Der Ministerrat gibt die allgemeinen politischen Prioritäten vor und kann in zehn verschiedenen Ausformungen auftreten, darunter Allgemeine Angelegenheiten, Auswärtiges, Wirtschaft und Finanzen. Zuständig für Migration ist der Ministerrat für Justiz und Inneres. Die Fachminister*innen entscheiden über die Gesetzentwürfe (Verordnungen, Richtlinien) der Europäischen Kommission. Sowohl der Ministerrat als auch das Europäische Parlament müssen dem Vorschlag zustimmen, damit ein Gesetz verabschiedet werden kann.
Die Europäische Kommission ist das vierte Gremium im institutionellen Gefüge. Ihre Mitglieder werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt und müssen vom EU-Parlament bestätigt werden. Die Kommission ist ein supranationales Organ der EU und nimmt vor allem Aufgaben der Exekutive wahr. Sie entspricht damit der Regierung in nationalstaatlichen Systemen.
Ökonomie
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU (Gesamtwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen) betrug 2019 – als das Vereinigte Königreich noch Teil der EU war – 16,4 Billionen Euro und damit 15,39 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Das GDP pro Kopf lag EU-weit 2020 bei 34.688 USD und damit bei 275 Prozent des weltweiten Durchschnitts.
Obwohl der Anteil der EU an der Weltbevölkerung lediglich 6,9 % beträgt, macht der Handel zwischen der EU und der restlichen Welt rund 15,6 % der weltweiten Ein- und Ausfuhren aus.[2] Die EU ist neben den Vereinigten Staaten und China einer der drei größten Weltakteur*innen im internationalen Handel. Auf die EU-Länder entfiel 2016 der zweitgrößte Anteil der weltweiten Ein- und Ausfuhren von Waren.
Im Mai 2021 lag die Arbeitslosigkeit bei etwa 7,3 %, wobei es extreme Ungleichheiten zwischen den 27 Staaten gibt. So lag die Quote in Griechenland und Spanien bei jeweils etwa 15 %, in Deutschland oder Tschechien hingegen nur bei kapp über 3 %.[3]
Ähnliche Unterschiede gibt es bei den Löhnen. 2020 lag der Nettojahresverdienst eines durchschnittlichen Erwerbstätigenpaares mit zwei Kindern bei durchschnittlich 51.400 Euro, wobei die Spanne von 12.800 Euro in Bulgarien bis 92.000 Euro in Luxemburg reichte[4]. Diese starken Unterschiede in den Lebensbedingungen haben in den vergangenen Jahren Migrationsbewegungen vor allem von Ost- nach Westeuropa nach sich gezogen. Viele Osteuropäer*innen leben in anderen EU-Staaten und arbeiten dort unter teils extrem ausbeuterischen Bedingungen, etwa in der Pflege, auf dem Bau, in der Gastronomie, Landwirtschaft und der Logistik-/Transportbranche. Verschiedene in den vergangenen Jahren erlassene EU-Regularien zu Mindestlöhnen für entsandte Beschäftigte haben daran kaum etwas geändert, sodass vor allem in Westeuropa heute ganze Branchen von billigen Arbeitskräften aus dem EU-Ausland leben. Das Forschungsteam „Decent Care Work“ der Universität Frankfurt etwa schätzt, dass allein bis zu osteuropäische 500.000 Migrant*innen als sogenannte „Live-Ins“ in deutschen Haushalten als private Pflegekräfte arbeiten und dabei massenhaft um den Mindestlohn betrogen werden.[5]
Osteuropäer*innen konkurrieren auf den europäischen Arbeitsmärkten dabei auch mit Geflüchteten, die zwar in bestimmten Fällen schon während des Asylverfahrens arbeiten dürfen, aber wegen fehlender Sprachkenntnisse und mangelnder Anerkennung mitgebrachter Qualifikationen oft deutlich schlechtere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben.
Insgesamt ist es gleichwohl so, dass es in der EU an Arbeitskräften mangelt. Trotz der Coronapandemie wächst die Wirtschaft 2021 voraussichtlich um 4,4 %, und damit ebenso stark wie jene von Schwellenstaaten.[6] Obwohl in vielen Regionen vor allem in Südeuropa Arbeitslosigkeit herrscht, kämpfen in einigen Ländern Branchen mit einem wachsenden Arbeitskräftemangel. 2,0 % der Arbeitsplätze in der EU waren im ersten Quartal 2021 unbesetzt. Die größten Engpässe verzeichnet Osteuropa, in Tschechien waren im ersten Quartal 2021 5,0 % der Stellen unbesetzt, der höchste Wert in der EU, gefolgt von Belgien (3,5 %). Länder wie Deutschland werben Fachkräfte aus Drittstaaten mit Kampagnen wie „Make it in Germany“ gezielt aus Drittstaaten wie Tunesien, Mexiko oder den Philippinen ab.
Migrationsbewegungen
In den 1950er bis 1970er Jahren gab es vor allem regionale Bewegungen von Geflüchteten und Vertriebenen als Folge des Zweiten Weltkriegs. Später kam die Wanderung von Südeuropa und Irland in die industriellen Zentren West- und Mitteleuropas hinzu, oft im Rahmen eines Regimes bilateraler Abkommen – die sogenannte „Gastarbeitermigration“. Ebenfalls in dieser Phase gab es Migration im Zusammenhang mit dem Prozess der Dekolonisierung, von Nord- und Zentralafrika, Süd- und Südostasien nach Belgien, Frankreich, in die Niederlande und Großbritannien. Vor allem Österreich, Deutschland und die Schweiz sahen den Bedarf an auszubeutender und kostengünstiger Arbeit nicht gedeckt, sie starteten in den 1960er Jahren Anwerbeprogramme in Nordafrika und der Türkei.
Nach der Ölkrise 1973 kamen die Gastarbeiterprogramme an ein Ende. Dies führte zu einer dauerhaften Ansiedlung von Arbeitsmigrant*innen, die in den Ländern blieben, in denen sie Arbeit gefunden hatten und ihre Familien vor allem aus Nordafrika und der Türkei nachholten. Weiterhin kamen in dieser Zeit Asylsuchende aus Osteuropa, die in Westeuropa Zuflucht suchen.
Binnenmigration
13,5 Millionen Personen, die in der EU leben, haben heute die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Mitgliedstaates (Intra-EU-Migration).[7]
Mit dem Schengener Abkommen 1985 wurde die sogenannten Personenfreizügigkeit vorbereitet, die seit 1993 als eine der vier „Grundfreiheiten“, neben der Warenverkehrsfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit und dem freien Kapital- und Zahlungsverkehr, in der EU garantiert ist. Zur Personenfreizügigkeit gehört die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Niederlassungsfreiheit. Für die im Zuge der Osterweiterung der Europäischen Union beigetretenen Länder bestanden zunächst Einschränkungen (zuletzt bis 30. Juni 2015 für Kroatien).
Die Konsolidierung und Ausweitung des EU-Freizügigkeitsregimes erleichterte die Mobilität von hoch- und geringqualifizierten Arbeitskräften und zog Bewegungen aus Mittel- und Osteuropa nach West- und Südeuropa nach sich. Die innereuropäische Migration ist seither insgesamt immer weiter gestiegen. 2019 gab es in der EU-28 17,9 Millionen sogenannte „EU-Mover“, von denen 13 Millionen im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jahre) waren.[8]
Unter den Entsendeländern entfallen dabei 58 % aller Migrant*innen auf Rumänien, Polen, Italien, Portugal und Bulgarien. EU-Ausländer*innen machen 3,7 % der gesamten Erwerbsbevölkerung in der EU-27, also ohne Großbritannien, aus. Die sogenannte „Nettomobilität“, der Wanderungssaldo aus Fort- und Zuzügen, lag 2018 bei 379.000. Die sogenannte Rückkehrmobilität stieg 2018 auf 738.000 und machte 65 % aller Abwanderungen von Staatsangehörigen aus. Das bedeutet, dass auf drei Personen, die ihr Herkunftsland verlassen, zwei zurückkehren.
Arbeitsmigration von außerhalb der EU
23 Millionen Menschen (5,1 %) der 447,3 Millionen Menschen, die am 1. Januar 2020 in der EU lebten, waren Nicht-EU-Bürger*innen.[9]
Ein Arbeitsvisum für die EU zu bekommen, ist heute für Drittstaatler*innen sehr schwierig und fast nur Fachkräften vorbehalten.
2019 zufolge haben die EU-Mitgliedstaaten etwa 3 Millionen erste Aufenthaltsgenehmigungen (Schengen-Visa) für Drittstaatler*innen ausgestellt,[10] davon 1,2 Millionen (40,5 %) zum Zweck der Arbeitsaufnahme. Weit über die Hälfte dieser Arbeitsvisa (625.000) entfiel allerdings auf ein einziges Land, nämlich Polen. Die Regierung versuchte mit der Visavergabe vor allem an Menschen aus der benachbarten Ukraine den Wegzug der eigenen Bevölkerung nach Westeuropa zu kompensieren.
Die weiteren 1,8 Millionen Schengen-Visa in 2019 wurden ausgestellt für erste Aufenthaltsgenehmigungen, die aus Familiennachzug (810.000, 27,4 %), „sonstige Gründe“ (546.000, 18,5 %) und Studium (400.000, 13,5 %).[11]
Insgesamt steht der Weg, mittels Visa legal nach Europa zu kommen, de-facto nur sehr wenigen Menschen offen. Von den rund 2,5 Millionen Schengen-Visa, die 2020 insgesamt weltweit ausgestellt wurden – also auch zu anderen Zwecken als Arbeitsaufnahme – , entfielen fast die Hälfte (1,17 Millionen, 47 %) auf die vier Schwellenstaaten China, Indien, Türkei und Russland. Weitere 307.000 wurden Bürger*innen aus den nordafrikanischen Staaten Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko erteilt. Staatsangehörige der beiden östlichen EU-Nachbarn Ukraine und Belarus bekamen rund 230.000 Visa (ca. 9 %). Auf sämtliche 45 Staaten Subsahara-Afrikas mit Ausnahme der Republik Südafrika entfielen zusammen nur 4,2 % (ca. 105.000) aller ausgestellten Visa.[12]
Flucht
Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes 1990 stiegen die Asylzahlen in der damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG) an. 1992 kamen 670.000 Asylsuchende in die heutigen EU-Staaten, die große Mehrheit aus Osteuropa. Sie waren nicht mehr Erfolgsnachweis in der globalen Systemkonkurrenz, sondern erschienen als zusätzlicher Kostenfaktor in der Krise des nationalen Sozialstaats. Staaten wie Deutschland verschärften die Bedingungen für eine Anerkennung erheblich, was die Zahl der Ankommenden für die folgenden ca. zwei Jahrzehnte drückte – auf EU-weit zwischen 220.000 und 420.000 pro Jahr.
Dabei veränderte sich die Zusammensetzung der Herkunftsländer immer weiter. Zunächst kamen Geflüchtete aus den Bürgerkriegsregionen Ex-Jugoslawiens, später Menschen, die vor sozialem Ausschluss und Diskriminierung (etwa Rom*nja aus Südosteuropa) oder mangelnden ökonomischen Perspektiven (etwa Arbeitsmigrant*innnen aus Bosnien) flohen. Ab 2000 kamen Kriegsflüchtlinge aus Afghanistan und Diktaturflüchtlinge aus dem Iran hinzu, ab 2010 Menschen aus den Kriegsregionen im Nahen Osten und solche, die aus den Ländern der Arabischen Revolutionen und Syrien flohen. In Folge eines geschwächten Grenzregimes in Nordafrika durch die Arabischen Revolutionen nahm ab 2010 auch die Zahl der Geflüchteten aus den Ländern südlich der Sahara zu – es waren sowohl Menschen aus Kriegsregionen Ostafrikas wie Somalia, Bewohner*innen von Diktaturen wie Gambia, Sudan oder Eritrea als auch Arbeitsmigrant*innen aus eher stabilen afrikanischen Staaten wie Nigeria, Ghana oder Senegal.
Von 2010 bis 2015 verfünffachte sich die Zahl der ankommenden Asylsuchenden in der EU insgesamt – von 259.000 (2010) auf 1,3 Millionen (2015) pro Jahr.[13] Daraufhin machte die EU den Kampf gegen die „irreguläre Migration“ zu ihrer zentralen politischen Priorität. Sie ergriff in vielen Politikbereichen einschneidenden Maßnahmen um Menschen auf der Flucht zu stoppen, möglichst noch vor der Ankunft, oder wieder abzuschieben.
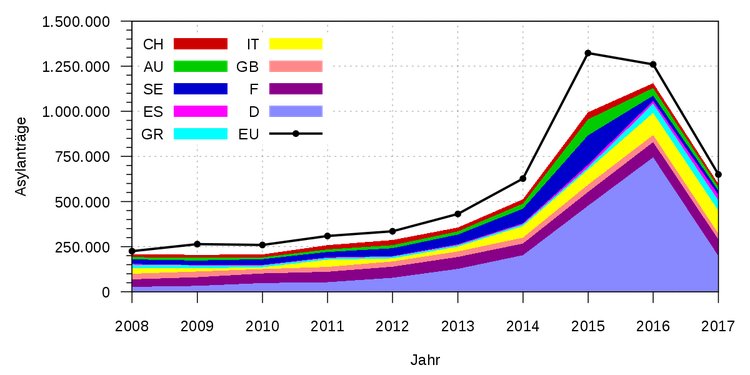
Das hatte Folgen: Die EU-Außengrenze ist zur tödlichsten Migrationsroute der Welt aufgerüstet worden. Seit Beginn der offiziellen Zählung durch die Internationale Organisation für Migration (IOM) 2014 bis Mitte November 2021 starben allein im Mittelmeer mindestens 22.863 Menschen,[14] Tausende starben auf dem Weg nach Europa in der Sahara. Etwa 70.000 Menschen wurden seit 2016 auf dem Mittelmeer gefangen und in libysche Internierungslager gebracht. Insgesamt liegt die Zahl der toten Flüchtenden auf dem Weg nach Europa seit Beginn der inoffiziellen Zählung durch die NGO United Against Racism 1993 bei über 45.000. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher.
Unter den Top 10 der Länder mit den meisten aufgenommenen anerkannten Flüchtlingen ist heute nur ein einziger EU-Staat (Deutschland, mit 1,2 Millionen). Insgesamt leben heute etwa 2 Millionen anerkannte Flüchtlinge in der gesamten EU – das sind etwa als 7 % der weltweit rund 26 Millionen internationalen Flüchtlinge.[15]
2020 lag die Zahl der ersten Asylanträge bei 416.000, dazu kamen noch etwa 60.000 Folgeanträge. Die wichtigsten Herkunftsländer waren 2020 Syrien, Afghanistan Venezuela, Kolumbien, Irak, Pakistan, Türkei, Bangladesch, Somalia, Nigeria, Guinea und Eritrea. Rund 770.000 Menschen warteten Ende 2020 auf eine Asylentscheidung. Im ersten Quartal 2021 wurden rund 34 % aller Anträge positiv entschieden[16] (gegen Ablehnungen sind allerdings Rechtsmittel möglich). Fast zwei Drittel (63 %) aller Asylanträge im Jahr 2020 wurden in nur drei Ländern gestellt: Deutschland (122.000), Frankreich (93.000) und Spanien (89.000). Mit einigem Abstand folgen Griechenland (41.000) und Italien (27.000).[17] Die meisten der 27 EU-Staaten nahmen also nicht nur praktisch keine Flüchtlinge auf, es wurden dort auch kaum Anträge gestellt.
2020 hat die EU rund 137.800 Menschen direkt bei der Einreise an der Grenze abgewiesen und 70.200 Menschen nach erfolglosem Asylantrag oder abgelaufener Aufenthaltserlaubnis abgeschoben.[18] Das sind die offiziellen Zahlen. Hinzu kommt eine unbekannte, sicherlich im fünfstelligen Bereich liegende Zahl offiziell nicht erfasster Pushbacks, illegaler Zurückschiebungen durch EU-Grenzschützer*innen in Nachbarstaaten der EU oder deren Küstengewässer, vor allem auf dem Balkan[19] (Bosnien, Serbien), in der Ägäis (Türkei)[20] sowie aus Spanien nach Marokko (Ceuta/Melilla). Etwa 15.000 Menschen[21] wurden allein in der ersten Hälfte 2021 auf dem Mittelmeer gefangen und in libysche Internierungslager gebracht, in vielen Fällen unter Beteiligung der Behörden Maltas[22] und Italiens[23] und finanziert von der EU.
Projekte der EU
Für die EU war die Aufhebung der Binnengrenzen das zentrale Element der inneren Einigung. Heute setzt sie als Projekt kaum etwas stärker unter Druck als die Unfähigkeit, die Migration von Außen kollektiv zu regeln. Im September 2020 schlug die Europäische Kommission einen „New Pact on Migration and Asylum“ vor, der aktuell (November 2021) noch vom Rat verhandelt wird.[47] Seine drei „Stockwerke“ betreffen die Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei der Externalisierung des Grenzregimes, die Sicherung der Außengrenzen durch Frontex, „Hotspots“ und Rückschiebungen und eine Entlastung der Erstaufnahmeländer innerhalb der EU.[48] Letztlich sind sich Mitgliedstaaten aber nur über die Sicherung der Außengrenzen einig und die Abriegelung der Transitrouten an die Außengrenzen ist weiterhin eine ihrer wichtigsten politischen Prioritäten.
Zentrale kollektive Regelungsversuche zum Umgang mit Migration und Geflüchteten
Aufhebung der Binnengrenzen: Das „Schengener Abkommen“
1985 unterzeichneten fünf Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft (EG) – dem Vorläufer der EU – in der Stadt Schengen das Schengener Übereinkommen. Die bis dahin zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden „Außengrenzen“ wurden damit zu „Binnengrenzen“ umgewandelt, an denen es fortan keine Kontrollen mehr geben sollte. Gleichzeitig wurde das verfassungsmäßige Recht auf Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit von Personen im „Binnenmarkt“vorbereitet, das heute förmliches Grundrecht gemäß der 2009 in Kraft getretenen „Charta der Grundrechte der EU“ ist.[24]
Auch wenn die EU-Binnenfreizügigkeit zunächst einmal nur die EU-Bürger*innen betraf, hatte das Schengener Abkommen schon bald weitreichende Auswirkungen auf die EU-Migrations- und -Asylpolitik. Denn mit dem Abbau der EU-Binnengrenzkontrollen wurde die Schließung der Außengrenzen zur kollektiven EU-Angelegenheit.
1990 schlossen die EG-Staaten einen weiteren Vertrag: Das Schengener Durchführungsübereinkommen, in dem vor allem Maßnahmen beschlossen wurden, die den Wegfall der innereuropäischen Kontrollen an den Außengrenzen auffangen sollen.
Es legt Regeln für Einreise, Ausweisung und Bewegungsfreiheit von Menschen aus Nicht-EU-Staaten fest. Die Länder begannen, die Außengrenzen stärker zu überwachen und eine Zusammenarbeit von Polizei und Justiz sowie ein Informationssystem aufzubauen, in dem sie Daten über Visa und Grenzkontrollen sammeln.[25]
Schengen hatte eine paradoxe Wirkung: Die härteren Kontrollen führten nicht zu einem Rückgang von Migration, sondern zu einem Anstieg. Immer mehr Menschen setzten sich in Boote, die sie ohne Visum über das Mittelmeer brachten. „Vereinzelt gab es diese Bootsmigration schon seit den 1970ern, populär wurde sie erst nach dem Abkommen von Schengen, weil sich verändert hatte, was legal war“, schreibt dazu Susan Djangahard.
Die Entwicklung zeigte sich besonders früh und deutlich in Melilla und Ceuta, den beiden spanischen Enklaven in Marokko. Hier grenzen die EU und Afrika auf 20 Kilometern direkt aneinander. Es ist der kürzeste Weg zwischen den beiden Kontinenten. Lange konnte jede*r diese Grenze einfach passieren, es gab nichts weiter als einen Grenzstein. Marokkaner*innen und andere Afrikaner*innen taten dies, um zu arbeiten, ebenso, wie sie damals Schiffe nach Andalusien besteigen konnten. Bis zum Juni 1991. Da trat Spanien dem Schengener Abkommen bei. Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, im März 1995, würde das Land zu einem neuen Raum der Freizügigkeit gehören: demjenigen der EU. Das verpflichtete Spanien, seine Grenzen als die der neuen Schengen-Gemeinschaft zu „schützen“. Spanien stand dabei unter Druck – das Land musste die Skepsis mancher europäischer Partner entkräften, dass es den „Schutz“ der EU-Außengrenze tatsächlich gewährleisten konnte. Marokkaner*innen brauchten von nun an ein Visum für Spanien. Die Armee wurde angewiesen, auf der Straße von Gibraltar niemanden durchzulassen. Die uralte Migrationsroute aus dem Maghreb- Raum nach Andalusien war unterbrochen. Die Freizügigkeit der Maghrebiner*innen wurde gegen die der Europäer*innen getauscht. Damit wenigstens ein paar seiner Untertan*innen überhaupt noch nach Spanien eingelassen wurden, musste Marokkos König Hassan II. das erste Rücknahmeabkommen unterzeichnen: Er sollte alle Migrant*innen zurücknehmen, die Spanien abwies. Die Abschiebung in deren Herkunftsländer war Spanien zu beschwerlich.

Dublin-Verordnung
Seit 2003 regelt die Dublin-Verordnung die Zuständigkeit der EU- Staaten bei Asylverfahren. Ihr ursprüngliches Ziel war es, sicherzustellen, dass es in Europa keine Geflüchteten gibt, die zwischen den Staaten hin- und hergeschoben werden, ohne dass jemand für sie die Verantwortung übernimmt – sogenannte „refugees in orbit“. Das ist an sich ein sinnvolles Ziel. Die Verordnung legt fest, dass in der Regel der Staat für einen Asylsuchenden zuständig ist, über den dieser in die EU eingereist ist. Diese Regelung führt dazu, dass die großen Länder im Zentrum Europas kaum Zuständigkeiten und Verantwortung für ankommende Menshcen übernehmen müssen – sie wurde deshalb von ihnen durchgesetzt. Maßgeblich beteiligt daran waren Deutschland und andere Länder im geographischen Zentrum der EU. Die Länder an den Außengrenzen sind von dieser Regelung massiv benachteiligt.
Menschen, die einen EU-Staat irregulär betreten, werden von der Polizei registriert. Danach können sie theoretisch nur im Land ihres EU-Eintritts einen Asylantrag stellen. Um das zu kontrollieren, werden Fingerabdrücke genommen und in einer zentralen Datenbank namens → EURODAC gespeichert. Wer trotzdem weiterreist, etwa nach Deutschland oder Schweden, tut dies unerlaubt und kann von den Behörden in diesen Länder wieder zurückgeschickt werden (sogenannte „Dublin-Abschiebungen“).
Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts sind die Zahlen geflüchteter Menschen stark gestiegen. Immer mehr Menschen kamen über den See- oder Landweg nach Europa – und somit in den an den Außengrenzen gelegenen Staaten an. Diese mussten sich wegen der Dublin-Regel allein um sie kümmern – und taten es nicht. Eine angemessene Infrastruktur fehlte und war politisch von den Regierungen auch nicht gewollt. Um die Zahlen zu drücken, setzten Länder wie Italien, Malta und Griechenland deshalb vor allem darauf, Geflüchtete schlecht zu behandeln: durch Internierung und unzureichende Versorgung. Viele Geflüchtete haben diese Länder deshalb wieder verlassen, etwa Richtung Deutschland oder Skandinavien.
Länder wie Deutschland haben zunächst versucht, die Menschen wieder in die Außengrenzen-Staaten zurückzuschieben, wie es das Dublin-System vorsieht. Das hat aber nicht funktioniert: Zum einen waren die Aufnahmebedingungen so schlecht, dass Gerichte Abschiebungen etwa nach Griechenland, später auch nach Ungarn und Italien immer wieder verboten haben. Zum anderen haben die betroffenen Länder nur sehr unwillig bei der Rücknahme kooperiert. Die Folge waren exzessive Inhaftierung, chaotische und völlig unzumutbare Zustände in Ländern wie Griechenland, eine riesige Zahl von Menschen, die irregulär – und oft erneut mit Schleppern – durch Europa reisten, ohne dass ihre Asylverfahren entschieden wurden. Die EU erhöhte den Druck auf die Länder an den Außengrenzen, diesen Zustand zu beenden und die Geflüchteten bei sich zu behalten. Eine Reihe der EU-Staaten aber will trotz massiver Beschwerden aus Ländern wie Italien und Griechenland unbedingt an dem Dublin-Prinzip festhalten.
Faktisch war das Ergebnis von Dublin nicht, dass die Länder an den Außengrenzen viele Geflüchtete als solche offiziell aufgenommen hätten, sondern dass sie ihnen die formale Aufnahme verweigerten, die Menschen daraufhin illegalisiert weiterzogen, in Länder, in denen ihnen wiederum Perspektiven verweigert wurden. Die, die in den Außengrenzen-Staaten blieben, wurden oft sich selbst überlassen. Die von Deutschland mit erdachte Dublin-Regelung hat somit dafür gesorgt, dass Flüchtlinge ertrunken, erstickt, erfroren, eingesperrt, misshandelt, zurückgewiesen, abgeschoben und Familien auseinandergerissen wurden, dass Staaten überfordert waren und dass das blutige Regime an den Außengrenzen seit 2017 von Jahr zu Jahr grausamer geworden ist.
Common European Asylum System (CEAS)
Das 2013 beschlossene Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) legt Mindeststandards für die Durchführung von Asylverfahren und die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden in der EU fest. Außerdem ermöglicht es den Abgleich von Fingerabdrücken von Asylbewerber*innen über die Datenbank → EURODAC und damit auch die Bestimmung des Landes, welches für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist (→ Dublin). Das GEAS umfasst drei Richtlinien (Qualifikations-, Aufnahme-, Asylverfahrensrichtlinie) und zwei Verordnungen (Eurodac- und Dublin-Verordnung). Es zielt auf die Angleichung der Asylsysteme der EU-Mitgliedstaaten, damit jede*r Asylbewerber*in gleich behandelt wird, egal, in welchem Mitgliedsland die Person einen Asylantrag stellt. „Asyl darf keine Lotterie sein“, erklärte die Kommission damals. „Es muss sichergestellt sein, dass Flüchtlinge gerecht behandelt werden und ihr Fall nach einheitlichen Standards geprüft wird, damit das Ergebnis unabhängig vom Ort der Antragstellung ähnlich ausfällt.“ CEAS sollte dafür sorgen, dass alle Staaten Europas Menschen mit Fluchterfahrung ähnlich behandeln. So sollte die Schieflage zwischen den Staaten im Süden und jenen im Zentrum ausgeglichen werden.
Die Umsetzung des GEAS verläuft in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten aber völlig uneinheitlich, sodass die Asylsysteme weiterhin große Unterschiede aufweisen. Fast alle Staaten ignorierten die neuen Regeln. Niemand wollte neue „Anreize“ für Flüchtende schaffen. Und die Kommission vermochte nichts dagegen zu tun. Das Leben für Geflüchtete innerhalb der EU ist noch immer extrem unterschiedlich. Sozialleistungen und Verfahrensdauer, vor allem aber die Anerkennungschancen unterscheiden sich erheblich. Eine der Folgen: Auch das Aufkommen der Asylanträge ist EU-weit extrem uneinheitlich. In Deutschland etwa erhalten alleinstehende erwachsene Asylbewerber*innen, die in Wohnungen leben, während ihres Verfahrens im Regelfall 351 Euro pro Monat. Die Gesundheitsversorgung ist auf akute und schmerzstillende Behandlungen beschränkt. In Lettland erhält jede*r Asylbewerber*in 139 Euro im Monat. Länder, die Geflüchtete schlecht versorgen – vor allem in Osteuropa – sind naheliegenderweise nicht deren erstes Ziel. Entsprechend gering ist deren Bereitschaft, sich höhere Standards vorschreiben zu lassen. Viele deutsche Innenpolitiker*innen würden daher die Sozialstandards gerne in Richtung des niedrigen, osteuropäischen Niveaus drücken. Das aber ist mit nationalem Recht unvereinbar: Das deutsche Bundesverfassungsgericht etwa hat 2012 entschieden, dass Geflüchteten das Existenzminimum nicht vorenthalten werden darf, um Zuwanderung abzuwehren.
Noch komplizierter ist die Angleichung der Anerkennungspraxis. Jeder EU-Staat ist in dieser Frage autonom. Die Folge: Es gibt genau die „Lotterie“, die die EU vermeiden wollte. Während etwa Bulgarien 2020 nur 13 % aller irakischen Antragsteller*innen anerkannte, waren es in Italien 95 %. Eine Angleichung wäre wohl nur über ein einheitliches EU-Verfahren möglich – etwa durch die noch embryonale EU-Asylbehörde → EASO auf Malta. Die EU-Kommission sähe es deshalb am liebsten, fiele ihr die Hoheit über die Asylverfahren zu. Das würde „die komplette Harmonisierung der Verfahren, aber auch der konsistenten Beurteilung von Schutzbedürfnissen auf EU-Ebene sichern“, heißt es bei der Kommission. Doch die meisten Mitgliedstaaten sind auf keinen Fall bereit, dieses Recht an Brüssel abzutreten.
EU-Agenturen/Institutionen
Frontex
2005 gründete die EU eine Behörde zur Sicherung der europäischen Außengrenzen mit Sitz in Warschau, Polen: Frontex. Mit den nationalen Grenzsicherungsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten ist sie für die Sicherung der Außengrenzen des Schengen-Raums zuständig. Sie koordiniert und plant sogenannte Grenzsicherungsmissionen, an denen sich die Grenzpolizeien der EU-Staaten beteiligen – mittlerweile auch außerhalb des EU-Territoriums. Frontex stellt dazu Beamt*innen, Schiffe, Flugzeuge und Ausrüstung bereit. Die Agentur führt „Risikoanalysen“ und Lagebeobachtungen durch, auf deren Grundlage die Kapazitäten und die Einsatzbereitschaft der einzelnen Grenzsicherungsbehörden bewertet werden. Sie trainiert Grenzschützer*innen innerhalb und außerhalb der EU und sammelt Informationen über Migrationsbewegungen weltweit. Seit Jahren versucht sie zunehmen Einfluss auf Migrationskontroll-Infrastruktur außerhalb der EU zu nehmen und diese zu „ertüchtigen“.
44 „Agenturen“ für bestimmte Politikbereiche hat die EU. Keine ist so schnell gewachsen und so üppig ausgestattet wie Frontex. Bei der Gründung 2005 verfügte sie über 45 Mitarbeiter*innen und einen Jahresetat von 6,5 Millionen Euro. 2020 konnte Frontex 320 Millionen Euro ausgeben. Für die Zeit von 2021 bis 2027 soll das Budget auf insgesamt 11 Milliarden Euro anwachsen – hauptsächlich zur Aufstellung einer „ständigen Reserve“ von 10.000 Grenzsicherungsbeamt*innen aus den Mitgliedstaaten und zur Anschaffung neuer Ausrüstung. Das eigene Personal soll auf 3.000 wachsen. Mehr als 90 % des Geldes kommen dabei von der EU-Kommission, der Rest direkt von den Schengen-Ländern.
Die EU will Frontex noch weiter ausbauen – am liebsten bis zu einer vollwertigen Grenzpolizei. Im September 2016 wurde Frontex dazu als „Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache“ neu konstituiert. Die Agentur bekam dabei eine ganze Reihe neuer Kompetenzen, unter anderem für die Durchführung von Abschiebungen.
Frontex-Missionen innerhalb der EU
Das Prinzip von Frontex lautete zunächst: EU-weit Material und Personal einsammeln und dorthin schicken, wo viele Flüchtende ankommen. Dazu wird zunächst evaluiert, wie die Mitgliedstaaten die eigenen Grenzen sichern. Frontex unterhält dazu Verbindungsbeamt*innen in den Mitgliedstaaten. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt viele Geflüchtete ankommen, bietet Frontex die Koordinierung und Organisation technischer und personeller Hilfe an. Dabei werden Teams aus Grenz- und Küstenwachen oder der Migrationsverwaltung anderer EU-Staaten zusammengestellt und entsandt. Ihnen wird Ausrüstung bereitgestellt. Die Teams werden vor Ort bei der Personenüberprüfung, der Befragung, der Identitätsfeststellung und der Abnahme von Fingerabdrücken eingesetzt. Frontex ist dabei an Screening-Verfahren beteiligt, in denen vorab entschieden wird, ob Ankommende überhaupt für eine reguläre Asylantragstellung infrage kommen. Das geschieht vor allem durch Ermittlungen zu deren Herkunftsstaat. Im Zweifelsfall können Frontex-Beamt*innen direkte Abschiebungen einleiten.
Solche Einsätze gab es in der Vergangenheit unter anderem vor den Kanarischen Inseln („Operation Hera I + II“), im Mittelmeer zwischen Nordafrika und Malta/Süd-Italien („Nautilus“), an europäischen Flughäfen bei der Kontrolle von Immigrant*innen aus Lateinamerika („Amazon“), auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa („Hermes“). Die „RABIT“ Operation überwachte die Grenze von Nord-Griechenland zur Türkei, sie wurde später in „Mission Poseidon 2011 Joint Operation“ umbenannt.
In den Folgejahren startete Frontex die Mission „Poseidon Land and Sea“ an der griechisch- und bulgarisch-türkischen Grenze und auf dem Seeweg von der Westtürkei und Ägypten nach Griechenland und Italien. Als „Triton“ firmierte der Nachfolger der italienischen Seenotrettungsmission Mare Nostrum zur Überwachung des Mittelmeers vor Libyen. „Triton“ wurde 2018 durch die Mission „Themis“ abgelöst.
Frontex-Einsatz in den „Hotspots“ und anderen Lagern
Bei der Operation („Hermes“) ab 2011 auf Lampedusa wurden erstmals so genannte „Screener“ und „Debriefer“ eingesetzt – Grenzschützer*innen aus Behörden verschiedener EU-Mitgliedstaaten, die sogenannten Bootsflüchtlinge auf Lampedusa identifizieren und befragen sollten – unter anderem über deren Transportwege.
Diese Einsatzform von Frontex verstetigte sich, nachdem die Europäische Kommission im Rahmen ihrer Europäischen Agenda für Migration ein Konzept von Erstaufnahme- und Registrierungszentren einführte: Die so genannten Hotspots. Sie sollten zunächst in Griechenland und Italien die ankommenden Flüchtlinge direkt an der EU-Außengrenze identifizieren, registrieren und ihre Fingerabdrücke abnehmen. Betrieben werden sie gemeinschaftlich von Frontex, → EASO, dem Europäischen Polizeiamt (Europol) und der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) mit den Behörden vor Ort. Ab diesen Zentren sollten temporären Umverteilungs-Mechanismen, genannt → Relocation greifen. Hotspots wurden bis 2017 in folgenden Städten eröffnet: Fünf auf den griechischen Inseln (Chios, Lesbos, Samos, Leros, Kos) und in Italien Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Taranto. Dort wurden seither alle ankommenden Asylsuchenden registriert. Dafür sind sowohl Vertreter*innen der nationalen Grenzbehörden als auch Mitarbeiter*innen von Frontex und → EASO zuständig.
Eigene Abschiebeoperationen
Schon seit einigen Jahren organisierte Frontex auf Bitten – und auf Kosten – der EU-Mitgliedstaaten gemeinsame Abschiebe-Charterflüge. Dabei wurden Menschen in Abschiebehaft aus einem gemeinsamen Herkunftsland aus ganz Europa zusammengebracht und dann, bewacht von europäischen Polizist*innen, in ihr Heimat geflogen.
Als „European Coast and Border Guard“ kann Frontex auch auf eigene Initiative und eigene Kosten solche Abschiebeflüge durchführen. So soll die Zahl der Abschiebungen erhöht werden, gleichzeitig verspricht man sich Effizienzgewinne von der Regelung, schließlich kann in ganz Europa nach einschlägigen Abzuschiebenden gesucht werden, um eine hohe Auslastung der Flugzeuge sicherzustellen. Schon die ersten Monate nach Beginn der Neuregelung zeigten: Die nationalen Ausländerbehörden machen davon gern Gebrauch – es ist ja nicht ihr Geld. „Return Support“ heißt diese Art der Serviceleistung von Frontex für Ausländerbehörden. 66,5 Millionen Euro stehen seit 2017 im Haushalt der Behörde jährlich dafür bereit: Das gecharterte Flugzeug, Unterkunft von Begleitpersonen, Verpflegung auf dem Boden, Kosten für medizinisches Personal und Dolmetscher*innen bezahlt Frontex. Ebenso sollen damit auch die Beschaffung von Pässen für Abzuschiebende und „freiwilige Ausreisen“ finanziert werden – alles Aufgaben, die bislang die Mitgliedstaaten selbst übernehmen mussten.
Damit die Mittel auch in Anspruch genommen werden, müssten alle EU-Staaten künftig die Daten ausreisepflichtiger Ausländer*innen automatisiert an Frontex übermitteln. Bislang schicken sie nur auf freiwilliger Basis Excel-Tabellen. Auf dieser Grundlage soll Frontex schneller Sammelabschiebe-Charter initiieren und abwickeln können, um die sogenannte Ausreisequote (See section Readmission as well as → Return) zu erhöhen.
Frontex hat dafür gesorgt, dass heute nicht mehr alle Abschiebeflüge aus Europa von der nationalen Polizei begleitet werden. Denn die EU-Agentur finanziert im Schnitt alle drei Wochen einen Flug, bei dem Herkunftsländer ihre etwa aus Deutschland abzuschiebenden Bürger mit eigenen Flugzeugen und Polizist*innen abholen. Bei diesen „collecting return operations“ genannten Aktionen bezahlt Frontex den Herkunftsländern nicht nur die Flugkosten, sondern teils auch Tagegelder für die Polizist*innen. Seit 2017 wurden mit 59 solcher Flüge rund 2.800 Menschen abgeschoben, vor allem nach Georgien, aber auch Montenegro, Serbien und die Ukraine.
Gleichzeitig baut Frontex einen Pool von sogenannten Rückkehrbegleiter*innen („forced return escorts“) auf. Dabei handelt es sich um Polizist*innen und Grenzsicherungsbeamt*innen der EU-Staaten, aus denen die Abschiebungen starten und die innerhalb der EU flexibel einsetzbar sind. Mittlerweile gibt es 690 solcher „Expert*innen“. Derzeit sind etwa vier Beamt*innen der Bundespolizei als „Escort Officer“ auf Lesbos in Griechenland eingesetzt – offenbar um von dort Abschiebungen in die Türkei durchzuführen.
Satellitengestützte maritime Situationsanalyse
2019 vergab → Frontex einen Auftrag über 1,5 Mio. Euro für eine sogenannte „Satellitenfunkfrequenz-Emitter-Detektion für die maritime Situationsanalyse“.[26] Damit sollen aus dem All Signale von maritimen Radaren, Schiffstranspondern oder Satellitentelefonen erkannt und lokalisiert werden. So sollen Schiffe oder Menschen, die Satellitentelefone benutzen, im Mittelmeer besser geortet werden können. Der Auftrag ging ohne Ausschreibung an das US-amerikanische Unternehmen HawkEye360. Zu den Investoren von HawkEye 360 zählen das US-amerikanische Medienunternehmen Advance, das europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus und der internationale Datenanalysekonzern Esri. Im Juli 2021 hat HawkEye 360 die letzten der insgesamt 20 aktiven Satelliten entsandt.[27]
Frontex begründete dies damit, dass „die durchgeführte Marktforschung eindeutig ergeben hat, dass es derzeit nur ein Unternehmen gibt, das in der Lage ist, die gewünschten Dienste zu erbringen“. HawkEye360, dessen Vorstand und Investor*innen sich aus einigen der weltweit größten Rüstungsunternehmen zusammensetzen und von hochrangigen Mitgliedern des US-Militärs und des Geheimdienstes beraten werden, hat seine ersten Satelliten mit Hilfe von Elon Musks SpaceX im Jahr 2018 gestartet und soll seine "Erfassungskapazität" in den kommenden Jahren mit mehreren Satelliten erweitern.
Im Oktober 2020 veröffentlichte Frontex eine Ausschreibung, laut der Frontex für den Zugang zu denselben Diensten mehr als fünf Millionen Euro für ein Jahr zahlen wollte. Die Daten sollen von Frontex-Analyseabteilung genutzt werden und über EUROSUR an verschiedene Stellen weitergeleitet werden.
Auf Anfrage der Organisation Privacy International erklärte Frontex, dass sich das Projekt immer noch in der Pilotphase befände und keine Kommunikation abgefangen würde. Es unterliegt allerdings der Geheimhaltungspflicht und die Agentur gibt deshalb keine weiteren Informationen preis.[28]
Hoheitliche Frontex-Operationen außerhalb des EU-Territoriums
Seit 2018 hat Frontex in einem Teil der Balkanstaaten besondere Rechte: Dort darf sie auch außerhalb des EU-Territoriums patrouillieren und hoheitliche Aufgaben – sprich: Abschiebungen – wahrnehmen. Das erste entsprechende Abkommen wurde dazu mit Albanien geschlossen.[29] Es sah vor, dass Frontex-Beamt*innen in Albanien die Grenze überwachen und Migrant*innen abschieben.[30] 2021 waren 71 Grenzschützer*innen aus 20 EU-Mitgliedstaaten in Albanien im Einsatz. Sie sollen sollen Albanien helfen, die unmarkierte „grüne Grenze“ zu überwachen und sind zudem an fünf Grenzübergängen präsent. Es ist der erste Einsatz in einem Nicht-EU-Staat, bei dem Frontex-Einsatzkräfte auch hoheitliche Befugnisse anwenden.
Ein gleichlautendes Abkommen wurde im Oktober 2019 mit Montenegro unterzeichnet. Im Juni 2021 waren dort etwa 80 Beamt*innen im Einsatz. Der dritte Staat, der Frontex entsprechende Befugnisse einräumte, war im Juni 2021 Serbien. Dorthin entsandte Frontex zunächst 44 Beamt*innen, wollte die Zahl in der Folge aber auf 87 aufstocken.[31]
Ähnliche Vereinbarungen mit Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina werden derzeit verhandelt.
Nicht-Hoheitliche Frontex-Aktivitäten außerhalb der EU
Für die Behörde ist die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern der Migrant*innen ein „Schlüsselelement erfolgreichen Migrationsmanagements“, so der Frontex-Direktor Fabrice Leggeri. Vom Informationsaustausch bis zur Abschiebungszusammenarbeit habe Frontex deshalb „seine Reichweite jenseits von Europa erweitert“. Die Verlagerung der europäischen Grenzsicherung an Orte weit jenseits des Schengen-Raums – das ist das Zukunftsprojekt von Frontex. Dazu hat die Agentur ein mehrstufiges Modell für das sogenannte „Integrierte Grenzmanagement“ entwickelt, das im Artikel 4 der Frontex-Verordnung von 2016 beschrieben ist. Ein Punkt dabei ist die „Zusammenarbeit mit Drittländern“, vor allem solchen, die „durch Risikoanalyse als Herkunftsländer und/oder Transit für illegale Einwanderung identifiziert wurden“. In diesen Fällen gibt das EU-Recht Frontex relativ freie Hand. Artikel 54 legt im Wesentlichen fest, dass Frontex sich bei der „Zusammenarbeit mit Drittländern“ der EU-Außenpolitik unterzuordnen hat.
Die Frontex-Operation Hera im Senegal
Das wichtigste Frontex-Projekt außerhalb der EU startete 2006 in Senegal. Damals gelangten 31.600 Menschen aus Westafrika auf die Kanarischen Inseln. Spanien schloss mit den Regierungen von Mauretanien und Senegal Verträge. Die Guardia Civil durfte kommen und im Senegal Migrant*innen verfolgen, fast so, als sei dies hier ihr eigenes Land. Ab 2009 war die sogenannte Atlantikroute zu. Fast keine Afrikaner*innen kamen mehr von Senegal aus zu den Kanaren durch. Frontex beteiligte sich am Einsatz der Spanier*innen firmiert als Frontex-Operation „Hera“. Im Hafen Dakars liegen seither Schiffe der Guardia Civil, Typ Rodman 101, 31 Meter lang, 1.500 PS, Nachtsichtgeräte, Infrarotkameras, moderne Radarsensoren, je zehn Personen Besatzung, Höchstgeschwindigkeit 64 Stundenkilometer. Jede Nacht fahren sie hinaus, unterstützt von einem Helikopter, den die Spanier*innen auf dem Flughafen von Dakar stationiert haben. Mit den Senegales*innen beobachten sie die Boote, die in Richtung Kanaren fahren, halten sie auf und schicken sie zurück. Offiziell unterstützt Spanien den Senegal nur. Tatsächlich „entscheiden wir, wohin wir fahren und welche Schiffe kontrolliert werden. Die Senegalesen führen das dann aus“, sagt einer der Grenzschützer. Die Arbeit sei „präventiv“, sagt er. „Die sollen wissen, dass wir hier sind, und gar nicht erst losfahren.“[32]
Spanien war das erste Land der EU, in das im letzten Jahrzehnt in größerer Zahl irreguläre Migrant*innen aus Afrika kamen. Und es war das erste, das auf die Idee kam, den Transitstaaten mehr Entwicklungshilfe zu geben, um diese zu blockieren. Mit seinem „Plan África“ ab 2004 vervierfachte Spanien seine Hilfsgelder in Westafrika. „Wir glauben, dass es sinnvoll ist, die Aufstockung der Entwicklungshilfe an die Ausarbeitung von Migrationsabkommen zu koppeln“, sagte der damalige Justizminister Juan Fernando López Aguilar.
Die Überwachung fängt nicht erst auf See an, sondern schon an Land. Dort sucht die Polizei nach Schleppern und Menschen, die die Überfahrt planen. „Die arbeiten mit dem spanischen Geheimdienst zusammen.“
Eine vergleichbare Kooperation, bei dem ein Nicht-EU-Staat europäischen Grenzpolizist*innen in diesem Maß faktische Hoheitsrechte einräumt, gab es lange nirgendwo sonst. „Spanien hat diese Grenzkontrollen und Rücknahmen von Ländern in Westafrika verlangt und bekommen“, sagt Louis Vimont, einst Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes EEAS. „Aber es ist dabei sehr geräuschlos vorgegangen, keine öffentlichen Erklärungen, das war das Geheimnis.“ Deswegen sei das Land damals weitergekommen als die Europäer*innen heute bei ihren Verhandlungen mit anderen afrikanischen Staaten.
Neun Monate im Jahr sind die Spanier*innen allein in Dakar. Von August bis Oktober – der Zeit, in der mit den meisten Überfahrten gerechnet wird – schickt Frontex Schiffe und Flugzeuge aus anderen EU-Staaten zur Unterstützung. Die Frontex-Präsenz hat dazu geführt, dass Senegales*innen, die nach Europa wollen, zuletzt meist den lebensgefährlichen Weg durch die Sahara, über Libyen und das Mittelmeer gewählt haben.
Frontex-Kooperation mit Partnerstaaten auf der Grundlage von „Working Arrangements“
Frontex hat bis Juli 2021 mit 18 Staaten formale „Working Arrangements“, Arbeitsabkommen geschlossen: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien, Kanada, Kap Verde, Georgien, Kosovo, Moldau, Montenegro, Nigeria, Serbien, Nordmazedonien, Russland, USA, Türkei und Ukraine. Die Abkommen erlauben Frontex mit Behörden dieser Länder zusammenzuarbeiten, Beamt*innen und Daten auszutauschen und gemeinsame technische Standards festzulegen. Über neue Abkommen verhandelt Frontex mit Libyen, Marokko, Senegal, Mauretanien, Ägypten und Tunesien. Unter anderem werden Beamt*innen aus diesen Ländern von Frontex trainiert, etwa bei der Erkennung gefälschter Passdokumente.
Training und Kooperation mit der libyschen Küstenwache
Seit November 2016 ist Frontex an der Ausbildung libyscher Küstenwächter durch die EU-Antischlepper-Militärmission Sophia (heute → „Irini“) beteiligt. Frontex hat ab 2016 Training für Offiziere der libyschen Küstenwache und Marine an Bord des italienischen Militärschiffs San Giorgio durchgeführt. Die Libyer wurden dabei von Frontex in der „Rechtsdurchsetzung auf See“, der „Vorbereitung und Planung von Strafverfolgungsmaßnahmen“ sowie der „Bekämpfung von Schmuggel und Menschenhandel“ geschult.[33] Unter anderem, weil unklar ist, inwieweit bewaffnete Gruppen in Libyens Küstenwache verstrickt sind, war die Ausbildungsmission stark umstritten. Sie ist aber einer der wichtigsten Bestandteile der Antischlepperpolitik der EU, denn die Küstenwache soll Flüchtende schon in libyschen Gewässern stoppen und nach Libyen zurückbringen – was sie seit 2016 in fast 70.000 Fällen getan hat. Dazu bekommt die libysche Küstenwache unter anderem Daten von Frontex.
2021 haben das ARD-Magazin Monitor, der "Lighthouse-Report", der "Spiegel" und "Libération" dokumentiert, dass Frontex-Flugzeug bei mindestens acht Rückführungen von Menschen in Seenot aus der maltesischen Such- und Rettungszone nach Libyen in der Nähe der Boote kreiste. Schiffe der libyschen Küstenwache hatten die Menschen aufgegriffen. Für die monatelange Recherche hatten die Reporter*innen die Flugrouten der Frontex-Flugzeuge mit den Rückführungen der libyschen Küstenwache und den Daten von Handelsschiffen in unmittelbarer Nähe verglichen. Gegenüber dem EU-Parlament erklärte Frontex am 4. März 2021, dass sie noch nie direkt mit der libyschen Küstenwache kooperiert hätten. Später ergänzte die Agentur, dass jedes Mal, wenn ein Frontex-Flugzeug ein Boot in Seenot sehe, „alle“ nationalen Seenotleitstellen, darunter auch Libyen informiert werde. Die zuständigen Seenotleitstellen seien dann für die Koordinierung der Rettung verantwortlich – und nicht Frontex.
Frontex-Projekte zur Informationssammlung außerhalb der EU durch „Risk-Analysis Networks“
Frontex hat insgesamt vier regionale sogenannte regionale „Intelligence Sharing Communities“ mit Drittstaaten aufgebaut. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Sammlung und der gemeinsamen Analyse der Migrations-Situation in Nicht-EU-Ländern. Dazu gehören das Risikoanalyse-Netzwerk für den westlichen Balkan (WB-RAN), das Risikoanalyse-Netzwerk für die Östliche Partnerschaft (EaP-RAN), das Risikoanalyse-Netzwerk für die Türkei-Frontex (TU-RAN).
Das wichtigste ist die 2010 gegründete Africa-Frontex-Intelligence Community (AFIC). Über 23-mal lud die Agentur seither Geheimdienstchefs der beteiligten Staaten aus Afrika nach Warschau ein. Beim AFIC sind bislang 28 Staaten, von Marokko über Dschibuti bis Angola, fest dabei, auch die Diktaturen Eritrea und Sudan. „Eingeladen“ hat Frontex Tunesien, Algerien und Äthiopien. Insgesamt macht so mehr als der halbe afrikanische Kontinent mit beim „Rahmen für Intelligence Sharing im Bereich der Grenzsicherung“, wie Frontex AFIC etwas umständlich nennt
Dafür werden auch fast alle Regime mit an den Tisch geholt, die für einen Teil der Flüchtenden verantwortlich sind. Schließlich gilt natürlich auch in Afrika: Je weniger ein Staat sich um Grund- und Menschenrechte schert, desto wichtiger ist der Geheimdienst als Stütze seiner Macht. Legt man die Ergebnisse des jüngsten sogenannten Democracy Index, einem von der Zeitschrift The Economist berechneten Index, der den Grad der Demokratie in 167 Ländern misst, zugrunde, so findet sich unter den AFIC-Staaten keine einzige Demokratie, fast alle sind als „autoritär“ und „hybrid“ eingestuft. Von ihnen schöpft Frontex systematisch Informationen ab und unterstützt sie dabei, ihrerseits Zugang zum Geheimdienstwissen anderer Staaten Afrikas zu erlangen.
Gab es zunächst nur AFIC-Treffen, werden heute auch Daten auf einer gemeinsamen Online-Plattform ausgetauscht. Dazu wurden die Geheimdienstmitarbeiter*innen Afrikas an den EU-Datenbanken geschult, ihnen Zugangsdaten ausgehändigt, damit sie alle drei Monate ihre Daten in die Frontex-Datenbank einspeisen können. Seit Mai 2016 entstehen daraus monatliche Analysen. Das Ziel: ein möglichst vollständiges, aktuelles Bild der Migration in ganz Afrika.
2016 war das Jahr, in dem AFIC zunehmend wichtiger für Frontex wurde. Unter jenen, die in Libyen auf Boote stiegen, waren damals kaum noch Menschen aus dem Nahen Osten, vielmehr stammten 91 % aus Afrika. Um den Afrikaner*innen den Eindruck zu vermitteln, AFIC sei auch ihr Projekt, gab es 2016 zwei Treffen in Afrika – in Ghana im März und in Mauretanien im Juni. Die afrikanischen Teilnehmenden durften dort selbst die Diskussionen leiten, wie Frontex stolz vermerkt. In dem jüngsten AFIC-Bericht finden sich Typologien der Schlepper (»Ghetto Boss«, »Fixer«, »Chasseur«), Angaben über die von ihnen bevorzugten Autotypen (»Toyota Hilux«) und Wochentage für den Beginn der Fahrt durch die Sahara (zuletzt »am liebsten sonntags«). Was nach Banalitäten klingt, verdichtet sich tatsächlich zu einem immer präziseren Bild der Migration innerhalb Afrikas. Die interessantesten Infos, so darf man annehmen, schreiben die Geheimdienste ohnehin nicht in öffentliche Berichte. Eine „beispiellose Plattform für Informationsaustausch“ nennt Frontex die AFIC.
Frontex-Projekte zur technischen Unterstützung der Grenzbehörden in Nicht-EU-Ländern
Frontex stärkt die Grenzsicherung in einer Reihe von Nicht-EU-Ländern durch gezielte technische Hilfsprojekte. Allen gemeinsam ist, dass sie in den begünstigten Ländern die Kapazitäten die Grenzkontrollen aufrüsten und, so Frontex, den „Grundstein für eine strategische Zusammenarbeit“ legen sollen oder „auf bereits bestehenden funktionalen Beziehungen“ aufbauen. Bis Mitte 2021 gab es vier solcher EU-finanzierter Projekte mit einem Gesamtvolumen von 14 Millionen Euro:
→ „EU4BorderSecurity“, rund 4 Millionen Euro für aus dem Fonds „Europäisches Nachbarschaftsinstrument“ für Staaten in Nordafrika um in den teilnehmenden Ländern „Vertrauen, Verständnis, strukturierte Partnerschaften und Austausch von Erfahrungen und Praktiken im Bereich des integrierten Grenzmanagements (IBM)“ aufzubauen
→ „Stärkung der Africa-Frontex Intelligence Community“, 4 Millionen Euro aus dem „Instrument zur Förderung von Stabilität und Frieden“ Fonds zur Konsolidierung des Informationsaustauschs
→ „Regionale Unterstützung für ein schutzbedürftiges Migrationsmanagement in den westlichen Balkanstaaten und der Türkei (IPA II), Phase II“, 3,4 Millionen Euro für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien und Türkei zur Unterstützung „bei der Entwicklung einer schutzsensiblen Reaktion auf gemischte Migrationsströme“
→ „Östliche Partnerschaft: Projekt zum Aufbau von Kapazitäten für integriertes Grenzmanagement (EaP)“, rund 4,5 Millionen Euro für Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldawien und Ukraine, zum „Verbesserung der Fähigkeit der am Grenzmanagement beteiligten Behörden“
Verbindungsbeamt*innen/“Liason Officers“ außerhalb der EU
Frontex hat ein Netzwerk von “Liason Officers“ genannten Verbindungsbeamt*innen aufgebaut, die in Nicht-EU-Ländern stationiert sind und dort dauerhaft direkten Kontakt mit den nationalen Grenzsicherungsbehörden halten. Mitte 2021 waren diese in der Türkei (mit Sitz in Ankara, seit 2016), Niger (mit Sitz in Niamey, seit 2017), dem Westbalkan (mit Sitz in Belgrad, Serbien, seit 2018), im Senegal (mit Sitz in Dakar, seit 2019), im Westbalkan (stationiert in Tirana, Albanien, seit 2021). In Planung ist die Entsendung für die „Östliche Partnerschaft“ (mit Sitz in Kiew, Ukraine). Seit Sommer 2017 unterstützt ein Frontex-Experte die EU Border Assistance Mission in Libyen (→ EUBAM) vor Ort. Frontex hat zudem Expert*innen entsandt, die als Verbindungsoffiziere mit EU NAVFOR Med Sophia (→ „Irini“) und der NATO-Operation in der Ägäis agieren.
Menschenrechtsverletzungen
Seit vielen Jahren haben Menschenrechtsgruppen auf massenhafte gewaltsame, teils tödliche Zurückschiebungen an Europas Außengrenzen aufmerksam gemacht. Zwar werden diese in der Regel durch die nationalen Grenzbeamt*innen durchgeführt. Teils geschieht dies aber unter Beteiligung von entsandten Frontex-Beamt*innen, im Rahmen von Frontex-Operationen oder unter Billigung Frontex. Ab 2020 mehrten sich die öffentlich bekannt gewordenen Skandale dieser Art dermaßen, dass Abgeordnete des EU-Parlaments 2021 den Rücktritt des Frontex-Direktors Fabrice Leggeri verlangten.

Dass Frontex die Abwehr von Menschen über die Grundrechte stellt, lässt sich lange zurückverfolgen. Im Zuge der ersten Mission, → Hera, wurden Boote, die aus Mauretanien oder dem Senegal zu den Kanarischen Inseln unterwegs waren, aufgehalten und zurückeskortiert. Teils wurden die Menschen auf den Booten in das Internierungslager Nouadhibou in Mauretanien gebracht. Nach einer Weile kamen fast keine Menschen mehr auf den Kanaren an. Wie hat Frontex das geschafft? Das in Berlin ansässige Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights) glaubt, dass die Grenzschützer*innen kurzerhand alle Aufgegriffenen zu „Mauretaniern und Senegalesen gemacht“ haben könnten, Asylanträge schlicht nicht geprüft und auch nicht wie vorgeschrieben Dolmetscher*innen hinzugezogen worden sein könnten. 2016 wollte das ECCHR dem Verdacht nachgehen, dass Frontex so gegen Grund- und EU-Rechte verstoßen haben könnte. Es verlangte Einsicht in zwölf wichtige Dokumente der Hera-Mission. Erst als das ECCHR rechtliche Schritte androhte, gab Frontex die Dokumente „heftig zensiert“ frei, so das ECCHR. Das „Handbuch für den Operativen Plan“ etwa wurde auf 48 von 99 Seiten geschwärzt, der Evaluationsbericht für die Hera-Mission auf 21 von 26 Seiten. Die von Frontex selbst angelegte „Liste potentieller Menschenrechtsverletzungen“ war gleich komplett aus den Akten entfernt worden. Frontex begründete die Schwärzungen gegenüber dem ECCHR mit einer „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“. So ist bis heute unklar, was die EU-Beamt*innen in den afrikanischen Gewässern jahrelang getan haben.
Menschenrechtsverletzungen in der Ägäis
Eine Kontrollgruppe des Europaparlaments hat im Juli 2021 festgestellt, dass Frontex beim Umgang mit mutmaßlichen Grundrechtsverletzungen an den Außengrenzen schwere Fehler begangen hat.[34] Im Zentrum der Untersuchung stand die Lage in der Ägäis. Dort versuchen immer wieder Menschen von der Türkei aus Griechenland zu erreichen. Die NGO Mare Liberum schreibt: „Beinahe täglich passieren Pushbacks an der griechisch-türkischen Grenze. Allein im Jahr 2020 zählten wir 321 Vorfälle in der Ägäis, bei denen 9.798 Personen zurückgedrängt worden sind.“ Die EU-Parlamentarier*innen schreiben mit Blick auf die Ägäis es sei „unklar“, ob es eine direkte Beteiligung von Frontex an den Handlungen gab. Allerdings habe Frontex Belege gefunden, die Vorwürfe von Grundrechtsverletzungen stützten. Sie habe aber "versäumt, diese Verstöße umgehend, wachsam und effektiv anzugehen und weiterzuverfolgen". Konkret wird das auch Direktor Fabrice Leggeri vorgeworfen. Er habe etwa im Frühjahr 2020 zu einem bestimmten Vorfall von den Griech*innen zunächst eine Untersuchung verlangt, sich dann aber mit deren Dementi zufriedengegeben. Das entsprach laut Bericht einem "Muster, dass eine Akte geschlossen wird, nachdem ein Mitgliedstaat den berichteten Vorfall verneint hat". Die Deutungen des Berichts unterscheiden sich aber auch unter Mitgliedern des Gremiums. Die Linke-Abgeordnete Cornelia Ernst sagte, dass der Bericht nicht von einer direkten Beteiligung von Frontex an Push-Backs spreche, sei "eine politische Entscheidung" gewesen, die von konservativen und rechten Kräften vorangetrieben wurde." Sie sieht diese Beteiligung als erwiesen an und fordert Leggeris Rücktritt.
Menschenrechtsverletzungen im zentralen Mittelmeer
2020 veröffentlichten die NGOs Alarm Phone, Sea-Watch, Borderline Europe und Mediterranea einen Bericht, in dem sie Frontex vorwarfen, sich per Luftüberwachung am Zurückschieben Zehntausender Menschen auf dem Mittelmeer nach Libyen beteiligt zu haben. Frontex-Flugzeuge würden Flüchtlingsboote aufspüren und die libysche Küstenwache zu diesen geleiten. „Akteure der EU sind damit zum Komplizen schwerer Menschenrechtsverletzungen geworden“, heißt es in dem Bericht „Crimes of the European Border and Coast Guard Agency Frontex in the Central Mediterranean Sea“. Die NGOs haben drei Seenotfälle aus dem Jahr 2019 detailliert untersucht und etwa mitgeschnittenen Funkverkehr mit der libyschen Küstenwache ausgewertet. In allen drei Fällen sind die Schiffbrüchigen am Ende nach Libyen zurückgebracht worden.
Am 2. Mai 2020 zum Beispiel sind zwei Boote vor Libyen in Seenot geraten und von Flugzeugen der Anti-Schlepper-Mission EUNAVFOR MED und der Luftwaffe von Malta entdeckt worden. Die italienische Rettungsleitstelle MRCC in Rom entschied, dass die Notfälle in die Zuständigkeit der libyschen Küstenwache fallen. Die beiden Flugzeuge teilten demnach den „zuständigen libyschen Behörden“ die genauen Koordinaten mit. Hilfsangebote von privaten Seenotrettungsorganisationen seien zurückgewiesen worden. Die Pilot*innen erklärten auf Anfrage eines NGOs-Flugzeugs, dass sie die Rettung mit den Libyern „koordinieren“.
Die beschriebenen Praktiken seien beispielhaft für ein „weit verbreitetes Muster“ des Verhaltens von EU-Behörden. Diese hätten eine „entscheidende Rolle“ bei der Ortung von Booten und der Koordinierung des Abfangens aus der Ferne, heißt es in dem Bericht. Entsprechend trüge sie klare Verantwortung für die erzwungene Rückkehr flüchtiger Menschen nach Libyen, „einem Land, das sich im Krieg befindet und in dem systematisch Menschenrechtsverletzungen begangen werden“.
2021 haben das ARD-Magazin Monitor, der "Lighthouse-Report", der "Spiegel" und "Libération" dokumentiert, dass Frontex-Flugzeug bei mindestens acht Rückführungen von Flüchtlingen in Seenot aus der maltesischen Such- und Rettungszone nach Libyen in der Nähe der Boote kreiste. Schiffe der libyschen Küstenwache hatten die Menschen aufgegriffen. Für die monatelange Recherche hatten die Reporter*innen die Flugrouten der Frontex-Flugzeuge mit den Rückführungen der libyschen Küstenwache und den Daten von Handelsschiffen in unmittelbarer Nähe verglichen. Gegenüber dem EU-Parlament erklärte Frontex am 4. März 2021, dass sie noch nie direkt mit der libyschen Küstenwache kooperiert hätten. Später ergänzte die Agentur, dass jedes Mal, wenn ein Frontex-Flugzeug ein Boot in Seenot sehe, „alle“ nationalen Seenotleitstellen, darunter auch Libyen informiert werde. Die zuständigen Seenotleitstellen seien dann für die Koordinierung der Rettung verantwortlich – und nicht Frontex.
Menschenrechtsverletzungen durch Frontex auf der Balkanroute
2019 berichtete das ARD-Magazin „report München“, dass die EU-Grenzsicherungsbehörde Frontex Menschenrechtsverletzungen und exzessive Gewalt an den EU-Außengrenzen zugelassen haben, die an Europas Grenzen von nationalen Grenzbeamten verübt wird. Die Vorwürfe lassen sich dem Bericht zufolge durch hunderte interne Frontex-Dokumente belegen. Die Berichte dokumentieren demnach unter anderem die „Misshandlung von Flüchtlingen“, „Hetzjagden mit Hunden“ und „Attacken mit Pfefferspray“. Die Vorwürfe beziehen sich unter anderen auf das Grenzsicherungspersonal in Bulgarien, Ungarn und Griechenland.[35] Im August 2019 leitete Frontex deshalb eine Untersuchung ein. 2020 berichtete auch das Magazin Balkaninsights ebenfalls über eine Serie von Gewalt gegen Geflüchtete durch Hunde an der serbisch-ungarischen Grenze, die Frontex toleriert habe.

Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (European Asylum Support Office, EASO)
Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO, englisch European Asylum Support Office) ist eine Agentur der Europäischen Union mit Sitz in Valletta auf Malta. Sie hat die Aufgabe, die praktische Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten im Asylbereich zu stärken und wirkt bei der Umsetzung des → Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, GEAS. Sie bereitet Asylentscheidungen vor, „unterstützt“ Mitgliedstaaten, deren Asylsystem besonders belastet ist und recherchiert und veröffentlicht für nationale Asylbehörden Informationen über häufige Herkunftsländer in COI-Berichten (Country of Origin Information). Außerdem ist sie für die Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU zuständig, sofern es dafür konkrete Programme (→ Relocation) gibt.
EASO verfügt 2021 über ein Budget von 142 Millionen Euro. Die meist aus anderen EU-Staaten entliehenen Asylbeamt*innen sind derzeit in Griechenland, Italien, Spanien und Zypern aktiv. Die Agentur ist eine zentrale Institution der europäischen Asylarchitektur, kaum eine EU-Behörde wächst derzeit so schnell. Ihre Bedeutung wird weiter zunehmen – wenn es nach der EU-Kommission geht, wird sie zu einer vollständigen supranationalen Asylbehörde ausgebaut. Das ist sie bis heute nicht und darf deshalb offiziell keinen eigenen „europäischen“ Asylentscheidungen treffen – das ist bis heute formal den nationalen Asylbehörden vorbehalten. Viele Mitgliedsstaaten bestehen darauf, sie fürchten, ansonsten von EASO als Flüchtlinge anerkannte Menschen aufnehmen zu müssen.
Ein „Instrument auf dem Weg zu einem umfassenden und schützenderen gemeinsamen europäischen Asylsystem“ soll sie sein, sagte die damalige EU-Kommissarin Cecilia Malmström 2011 bei der Eröffnung. Damals war der Handlungsdruck auf die EU-Kommission angesichts gestiegener Ankunftszahlen von Geflüchteten in Südeuropa gewachsen. Brüssel hatte vorgeschlagen, Beamt*innen aus anderen Mitgliedsstaaten nach Italien und Griechenland zu schicken, damit diese dort Asylanträge bearbeiten, um die enormen Wartezeiten zu verringern. Das ist bis heute eine der Haupttätigkeiten von EASO.
2011 und 2012 hat das EASO erstmals insgesamt 600 Flüchtlinge aus Malta in die übrige EU verteilt. Zu der Zeit waren die Internierungslager dort völlig überfüllt, die Menschen saßen selbst nach der Anerkennung auf der Insel fest. Es war ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es war ein Anfang, das → Dublin-Dogma, nach dem jeder Mitgliedstaat allein für alle Menschen zuständig ist, die über seine Grenzen in die EU kommen, infrage zu stellen.
Doch für diese Art der Umverteilung, → Relocation genannt, gibt es bis heute nur wenige Plätze. Dafür hat die EU ab 2015 sogenannte → „Hotspots“, → Lager, an den südlichen Außengrenzen der EU eingerichtet – fünf Hotspots auf den griechischen Inseln (Chios, Lesbos, Samos, Leros, Kos) und vier in Italien (Lampedusa, Pozzallo, Taranto, Trapani). Dort wurden alle ankommenden Asylsuchenden registriert, dafür waren sowohl Vertreter*innen der nationalen Grenzbehörden als auch Mitarbeiter*innen der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) und des EASO zuständig. Diese Registrierung weitete sich später zu einer de-facto Asylprüfung aus, in deren Zuge EASO heute vor allem in Griechenland die Asylentscheidungen vorbereitet, die anschließend von den nationalen griechischen Asylbeamt*innen nach Aktenlage – also ohne persönliche Anhörung der Antragstellenden – in der Regel bestätigt werden.
In Griechenland müssen Geflüchtete, die in den Hotspots registriert wurden, zunächst auf den Inseln bleiben. Sie erwarten hier zwei Optionen: Sie werden im Rahmen des sogenannten EU-Türkei-Deals zurück in die Türkei überstellt, wo sie einen Asylantrag stellen können. Oder sie stellen einen Asylantrag in Griechenland. In diesem Fall dürfen sie die Insel nicht verlassen, bis der Antrag bearbeitet wurde. In Italien werden Geflüchtete nach der Registrierung in zwei Gruppen aufgeteilt: Asylsuchende und vermeintliche "Wirtschaftsflüchtlinge". Erstere werden in einem Aufnahmezentrum (CARA) oder in einer Notunterkunft (CAS) untergebracht und können einen Asylantrag stellen. Letztere werden in einem "Ausreisezentrum" (CIE) festgehalten und daraufhin abgeschoben.
Europaparlament und Mitgliedstaaten haben sich Mitte 2021 auf eine Stärkung der EU-Asylagentur EASO verständigt. Aus EASO soll eine "vollwertige Behörde" werden. Dazu soll eine Reserve von 500 Expert*innen und Übersetzer*innen aufgebaut werden. Ab 2024 bekommt EASO auch stärkere Befugnisse, die Umsetzung der Asylgesetzgebung in den Mitgliedstaaten zu überwachen und eine*n „Grundrechtsbeauftragte*n“.
Der Europäische Auswärtige Dienst (European External Action Service, EEAS)
Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD; Englisch European External Action Service, EEAS) ist der diplomatische Dienst der EU. Er ist dem*der Hohen Vertreter*in der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik („Außenkommissar*in“) unterstellt, einer Art Außenminister*in der EU. „Eine Art“, weil die EU kein Staat ist und als solche eigentlich keine Botschaften und Botschafter*innen haben kann, gleichwohl werden die Vertreter*innen des EEAS international solchen gleichgestellt behandelt. Die Zentrale des EEAS befindet sich in Brüssel, zudem hat er 142 so genannte „Delegationen“, wie die Botschaften heißen, in Drittländern und bei internationalen Organisationen. Personell setzt sich der Dienst zusammen aus mindestens 60 % EU-Beamt*innen sowie aus mindestens einem Drittel Bediensteten auf Zeit, die von den nationalen diplomatischen Diensten der Mitgliedsstaaten abgeordnet werden. Unter der früheren Außenkommissarin Federica Mogherini hat der EEAS sich zentral um die Migrationskontrolle bemüht und unter anderem die Ausbildung der sogenannten → libyschen Küstenwache oder den → Valletta-Gipfel, den → EUTF, den → Joint Valletta Action Plan oder die → Facility for Refugees in Turkey organisiert. Hintergrund war unter anderem, dass vielen der EU-Mitgliedstaaten lange suspekt war, dass die EU eigene Außenpolitik jenseits der nationalen Ebene betreibt. Mit dem Fokus auf die Migrationsdiplomatie erhoffte der EEAS sich politische Erfolge erarbeiten zu können, um den eigenen Ausbau gegenüber den Mitgliedsstaaten leichter legitimieren zu können.
Projekte der EU zur Migrationskontrolle auf dem EU-Territorium
Zu den Grenzsicherungs-Projekten, die direkt von Frontex betrieben werden siehe Frontex-Missionen innerhalb der EU
Lager
Hotspots
2015 beschloss die Europäische Kommission im Rahmen ihrer "Europäischen Agenda für Migration" ein Konzept von Erstaufnahme- und Registrierungszentren: Die so genannten Hotspots. Sie sollten zunächst in Griechenland und Italien die ankommenden Flüchtlinge direkt an der EU-Außengrenze identifizieren, registrieren und ihre Fingerabdrücke aufnehmen. Betrieben werden sie gemeinschaftlich von Frontex, → EASO, dem Europäischen Polizeiamt (Europol) und der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) mit den Behörden vor Ort. Ab diesen Zentren sollten temporären Umverteilungs-Mechanismen, genannt → Relocation greifen.
Die Hotspots wurden bis 2017 in folgenden Städten eröffnet: Fünf auf den griechischen Inseln (Chios, Lesbos, Samos, Leros, Kos) und in Italien Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Taranto. Dort wurden seither alle dort ankommenden Asylsuchenden registriert. Dafür sind sowohl Vertreter*innen der nationalen Grenzbehörden als auch Mitarbeiter*innen von Frontex und → EASO zuständig.
Diese Registrierung weitete sich später zu einer de-facto Asylprüfung aus, in deren Zuge EASO heute vor allem in Griechenland die Asylentscheidungen vorbereitet, die anschließend von den nationalen griechischen Asylbeamt*innen nach Aktenlage – also ohne persönliche Anhörung der Antragstellenden – in der Regel bestätigt werden.
In Italien werden Geflüchtete nach der Registrierung in zwei Gruppen aufgeteilt: Asylsuchende und vermeintlichen "Wirtschaftsflüchtlinge". Erstere werden in einem Aufnahmezentrum (CARA) oder in einer Notunterkunft (CAS) untergebracht und können einen Asylantrag stellen. Letztere werden in einem "Ausreisezentrum" (CIE) festgehalten und daraufhin abgeschoben.
In Griechenland müssen Geflüchtete, die in den Hotspots registriert wurden, zunächst auf den Inseln bleiben. Der EU-Türkei-Deal sieht vor, dass Flüchtlinge in der Regel erst nach Abschluss des Asylverfahrens auf das griechische Festland gebracht werden, und für die gesamte Dauer ihres Asylverfahrens und gegebenenfalls bis zu ihrer Rückführung im Hotspot bleiben müssen. Die Folge war eine extreme Überfüllung der Aufnahmeeinrichtungen auf den Inseln. in den chronisch überbelegten Hotspots lebten zwischenzeitlich rund 38.000 Menschen.
Sie hatten hier zwei Optionen: Sie werden zurück in die Türkei überstellt, wo sie einen Asylantrag stellen können. Oder das Stellen einen Asylantrag in Griechenland. In diesem Fall dürfen sie die Insel nicht verlassen, bis der Antrag bearbeitet wurde.
Der größte der „Hotspots“ war bis zu einem Brand im September 2020 das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Hilfsorganisationen berichten schon bald nach dessen Eröffnung von katastrophalen Zuständen in dem Lager, in dem zeitweise über 10.000 Menschen waren. 2017 hieß es in einem Bericht der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, Neuankömmlinge in den Lagern müssten teils auf Pappkartons auf dem Boden schlafen. Selbstmordversuche, Selbstverletzungen oder psychotische Erkrankungen hätten in jenem Sommer um 50 % gegenüber den vorigen drei Monaten zugenommen. Auch Schwerkranke würden interniert, wenn ihr Asylantrag abgelehnt werde. Die Lebensumstände auf den Inseln trieben die Insassen zur Verzweiflung: „Jeden Tag behandeln unsere Teams Patienten, die ihnen sagen, dass sie lieber in ihren Heimatländern gestorben wären, als hier gefangen zu sein“, so eine Mitarbeiterin von Ärzte ohne Grenzen. Besonders Schutzbedürftige, etwa Kranke oder Opfer sexualisierter Gewalt, haben Anspruch auf eine Verlegung auf das Festland. Die griechischen Behörden hätten jedoch die Zahl der Beamt*innen, die ermitteln sollen, wer zu dieser Gruppe gehört, stark reduziert, obwohl immer mehr Menschen ankommen, so MSF.
Die Zustände wurden in den folgenden Jahren schlimmer. Nicht weniger als drei hintereinander gebaute Mauern und Stacheldrahtzäune trennten das Lager von der Außenwelt. Tatsächlich war Moria bei seiner Eröffnung im Jahr 2013 als Gefängnis für Geflüchtete gedacht. Aber irgendwann mussten die Behörden das Lager öffnen – zu viele Menschen sollten hier untergebracht werden. 3.000 Plätze gibt es offiziell, 2018 waren rund 10.000 Menschen dort. Das umzäunte Containerlager verschmolz mit einer vermüllten Siedlung rundum. Das Leben der Menschen bestand aus Warten: Dreimal am Tag je eine Stunde auf das Essen. Einen Monat auf ärztliches Personal. Ein Jahr auf das Asylinterview. Schon für Erwachsene ist das lang. Aber mehr als ein Drittel der Bewohner in Moria waren Kinder. Sie verlieren viel Zeit. Eine Schule gab es nicht, nur eine Schweizer NGO, die Unterricht organisierte. Das Einzige, was hier schnell geht, ist die Rückkehr: Wer dahin will, wo er hergekommen ist, konnte zum Büro der UN-Migrationsagentur IOM (Internationale Organisation für Migration) gehen und wurde schon bald ausgeflogen. 90 Euro bekam jede*r im Lager pro Monat zusätzlich zum Essen. Je Familie ist die Leistung allerdings 330 Euro gedeckelt. Die Aufnahmebedingungen machten viele krank. MSF (Médecins Sans Frontières, Ärzte ohne Grenzen) berichtete immer wieder von Magen-, Haut und Atemwegsinfektion. Fast ein Viertel der Kinder und Jugendlichen, mit denen Mitarbeiter*innen der internationalen Hilfsorganisation 2019 Therapiegespräche führten, hätten daran gedacht oder versucht, sich umzubringen, so Ärzte ohne Grenzen. „Stellen Sie sich Eltern vor. Die bringen ihre Kinder aus dem Krieg hierher, und dann können sie sie wochenlang nicht waschen“, sagte eine Ärztin.
Nach Angaben der EU-Kommission bekam Griechenland von 2015 bis 2019 1,5 Milliarden Euro für die Versorgung von geflüchteten Menschen. Doch immer wieder heißt es, Griechenland rufe das Geld nicht vollständig oder nur langsam ab. Tatsächlich dürfte der griechischen Regierung wohl an den Elendsbildern gelegen sein. Denn Athen will kein Geld für die Menschen selbst. Die Regierung will, dass andere EU-Staaten sie aufnehmen.
In der EU wiederum gibt es für einen solchen Verteilmechanismus keine Mehrheit. Die EU-Kommission will diese sogenannten Hotspots – und zwar nicht bloß zu Zwecken der Registrierung. Dass Risiko, lange Zeit dort festzusitzen, hat eine strategische Funktion. Es soll abschrecken. Denn die Ägäis ist nach wie vor eine der wichtigsten Fluchtrouten. Rund zwei von drei Flüchtenden, die in der Türkei abzulegen versuchen, hält die türkische Küstenwache auf – das ist Teil ihrer Abmachung mit der EU. Doch ungefähr 170.000 Menschen sind seit dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals im März 2016 auf den Ägäischen Inseln angekommen.[36] Die EU hat darauf gesetzt, dass die meisten wieder in die Türkei abgeschoben werden. Von April 2016 bis Mai 2019 geschah dies aber nur rund 2.460 Mal, auch weil die griechischen Behörden die Türkei unter anderem deshalb nicht für sicher hielten, weil dieses Land nach Syrien und Afghanistan abschiebt.
Asyl gewähren wollte Griechenland aber auch nicht. Es war eine paradoxe Situation. Statt eines regulären Asylverfahrens wurde offiziell nur geprüft, ob die Türkei für die Flüchtlinge ein sicherer Ort wäre. Bei Opfern von Schiffsunglücken, Schwangeren, chronisch Kranken, Behinderten, Folteropfern, alten Menschen oder unbegleitete Minderjährigen wurde das verneint. Ihre Asylanträge wurden bearbeitet. Jene der übrigen nicht. „Das Kriterium der Verletzlichkeit tritt an die Stelle des Rechts“, sagt Thomas Gebauer von der Hilfsorganisation medico international dazu.
Im Juni 2021 allerdings erklärte Griechenland die Türkei zum „sicheren Drittstaat“ für Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia. Griechenland hat damit die Abschiebungen dieser Menschen in die Türkei legalisiert.
Meistens sitzen die Menschen erst Jahre auf den Inseln fest, bevor sie auf das Festland dürfen und sich selbst überlassen werden. Ein Teil versucht weiterzukommen, etwa nach Deutschland. Legal aber ist das kaum möglich. Ein kleinerer Teil versucht mit falschen Pässen aus Griechenland wegzukommen. Insgesamt registrierte Frontex 2019 EU-weit 6.667 solcher Fälle. Diese sei „auf den deutlichen Anstieg der Abflüge von Syrern, Afghanen, Irakern, Iranern und Türken aus Griechenland zurückzuführen“, so Frontex.
Im September 2020, nach einem halben Jahr Corona-Lockdown, brannte Moria schließlich vollständig nieder. Ein Teil der Insassen wurde auf das Festland gebracht, die anderen kamen in ein neues Camp, wenige Kilometer weiter.

Die EU „macht die Politik, die all jene Bilder von verzweifelten Menschen in Zelten produziert, die man regelmäßig im Fernsehen sieht. Die Vorstellung, dass es sich bei den Zuständen auf Lesbos um eine humanitäre Katastrophe handelt, ist daher irreführend. Sie verdeckt, dass der Moria-Komplex Ergebnis politischer Entscheidungen ist und versperrt die Möglichkeit, die Rechte von Geflüchteten ins Zentrum der Auseinandersetzung zu stellen", sagt der Politikwissenschaftler Maximilian Pichl, Autor der 2021 erschienenen Studie „Der Moria-Komplex“.
Zukünftige Lager für Grenzverfahren
Künftig sollen die Hotspots in „Closed Centers“ genannte geschlossene Lager umgewandelt werden – so will es die 2020 präsentierte „Agenda on Migration“ der EU-Kommission.

In den bisherigen „Hotspots“ sollen „verbindliche Vorprüfungen“ von Asylgesuchen für mögliche Asylverfahren in anderen EU-Staaten stattfinden. → EASO soll dann entscheiden, in welchem EU-Staat das eigentliche Asylverfahren durchgeführt wird. Doch wer schon im Closed Center dabei ausgesiebt wird, weil er oder sie angeblich unbegründet einen Asylantrag stellen will – etwa wegen Einreise aus einem sicheren Drittstaat, falscher Angaben zur Identität oder aus anderen Gründen –, soll gar nicht erst in die EU einreisen dürfen, sondern direkt abgeschoben werden. „Verweigerung der Einreise heißt Rückkehr“, heißt es dazu in einem Konzeptpapier der deutschen EU-Ratspräsidentschaft von 2020. „Dabei muss Frontex helfen.“
Die Lager hätten damit eine Art exterritorialen Charakter. Rund zwei Drittel der Asylbewerber*innen könnten so nach Schätzung des deutschen Bundesinnenministeriums, das das Konzept für die Phase erarbeitet hatte, gar nicht erst einreisen. „Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Million in Europa zu verteilen habe oder zwei-, dreihunderttausend“, sagte der deutsche Innenminister Horst Seehofer. Auf die Frage, ob er wolle, dass „die Asylverfahren nicht mehr in Deutschland stattfinden sollen, sondern alle in den Hotspots selbst, sodass nur noch Anerkannte verteilt werden“, sagte Seehofer: „Letzteres ist unser Ziel.“ Dabei darf EASO keine Entscheidungen darüber treffen, wer Asyl bekommt oder für ein Verfahren zugelassen wird. Völlig unklar ist, was mit jenen geschieht, die bei der Vorprüfung zwar abgelehnt, aber gar nicht abgeschoben werden können.

„Return“
In ihrer 2020 präsentierten „Agenda on Migration“ schreibt die EU-Kommission, dass jedes Jahr zwischen 400.000 und 500.000 ausländische Staatsangehörige aufgefordert werden, die EU zu verlassen, weil sie „illegal eingereist sind oder sich unrechtmäßig in der EU aufhalten“. Allerdings würden nur 40 % von ihnen in ihr Heimatland oder in das Land, aus dem sie in die EU eingereist sind, zurückgeschickt. Die Kommission erweckte den Eindruck, als läge es daran, dass sich in der EU niemand um Abschiebungen kümmere und die Abschiebepatenschaften (und ein*e zusätzlich zu ernennende*r „Abschiebe-Koordinator*in“) diesen Mangel beheben würden. Tatsächlich sind die Lasten der Abschiebungen längst europäisch kollektiviert: Seit Jahren wird → Frontex aufgerüstet, damit mehr und schneller abgeschoben wird. Dass trotzdem „nur“ ein Drittel aller Abgelehnten pro Jahr abgeschoben werden, liegt nicht daran, dass die Außengrenzen-Staaten mit den Abschiebungen alleingelassen werden und es deshalb die Patenschaften bräuchte. Der Grund ist, dass viele Menschen trotz abgelehnten Asylantrags nicht abgeschoben werden können: Weil sie krank sind oder in Ausbildung, weil sie minderjährig sind, weil sie aus einem Kriegsgebiet stammen, weil sie keinen Pass haben, ihre Identität unklar ist, weil ein Gerichtsverfahren noch nicht entschieden ist, weil sie untergetaucht sind oder weil ihre Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen. Ein Teil von ihnen ist ausreisepflichtig, und trotzdem haben sie Rechte, die einer Abschiebung entgegenstehen können.
Abschiebungen durch Frontex
Schon seit einigen Jahren kann Frontex auf eigene Initiative und eigene Kosten Abschiebeflüge durchführen. „Return Support“ heißt diese Art der Serviceleistung von Frontex für Ausländerbehörden. 66,5 Millionen Euro stehen seit 2017 im Haushalt der Behörde jährlich dafür bereit: Das gecharterte Flugzeug, Unterkunft von Begleitpersonen, Verpflegung auf dem Boden, Kosten für medizinisches Personal und Dolmetscher*innen bezahlt Frontex. Ebenso sollen damit auch die Beschaffung von Pässen für Abzuschiebende und „freiwilige Ausreisen“ finanziert werden.
Zudem organisiert und bezahlt die EU-Agentur im Schnitt alle drei Wochen einen Flug, bei dem Herkunftsländer ihre abzuschiebenden Bürger*innen mit eigenen Flugzeugen und Polizist*innen abholen. Bei diesen „collecting return operations“ genannten Aktionen bezahlt Frontex den Herkunftsländern nicht nur die Flugkosten, sondern teils auch Tagegelder für die Polizist*innen. Seit 2017 wurden mit 59 solcher Flüge rund 2.800 Menschen abgeschoben, vor allem nach Georgien, aber auch Montenegro, Serbien und die Ukraine.
Gleichzeitig baut Frontex einen Pool von sogenannten Rückkehrbegleiter*innen („forced return escorts“) auf. Dabei handelt es sich um Polizist*innen und Grenzsicherungsbeamt*innen der EU-Staaten, aus denen die Abschiebungen starten und die innerhalb der EU flexibel einsetzbar sind. Mittlerweile gibt es 690 solcher „Expert*innen“.
„Abschiebepatenschaften“
In Zukunft sollen möglichst alle an den Außengrenzen Ankommenden in sogenannten → Closed-Centers untergebracht werden. Wer bei der dortigen Asyl-Vorprüfung durchfällt, soll direkt wieder abgeschoben werden. Um dies zu beschleunigen, plant die EU sogenannte „Rückführungspatenschaften“. Solidarität könne auch heißen, die Lasten der Abschiebungen zu teilen, verkündete dazu die Kommission. Dazu will die Kommission festlegen, dass alle Staaten freiwillig Aufnahmequoten für ankommende Geflüchtete erfüllen sollen. Tun sie das nicht, sollen sie ersatzweise eine Anzahl abgelehnter Asylbewerber*innen aus den Außengrenzen-Staaten abschieben. Dafür haben sie pro Fall acht Monate Zeit. Gelingt ihnen das nicht, müssen sie die Betreffenden doch selber aufnehmen. Angenommen, das Modell der „Paten-Abschiebungen“ lässt sich umsetzen – und bulgarische Polizist*innen würden etwa nach Valletta reisen, um von dort abgelehnte Asylsuchende nach Ghana zu bringen: Es ist zu bezweifeln, dass Staaten, die seit Jahren die Konfrontation mit Brüssel suchen, um keine asylsuchenden Menschen aufnehmen zu müssen, sich um die Rechte der anderswo Abgelehnten kümmern. Denn ansonsten müssten sie diese zu sich ins Land lassen. Die Entrechtung der Geflüchteten ist in dem Modell schon eingebaut.
Rücknahme/Readmission
Rücknahmeabkommen sind ein völkerrechtliches Kuriosum. Eigentlich dürfte es sie gar nicht geben: Das Völkerrecht regelt, dass jeder Staat seine eigenen Bürger*innen wieder einreisen lassen muss. In einem Abkommen, unterzeichnet in Benins Hauptstadt Cotonou, aus dem Jahr 2000 hat die EU den sogenannten AKP-Staaten – also den Staaten Afrikas, des Pazifiks, der Karibik – noch einmal die Zusicherung abgenommen, dass sie alle ihre Bürger*innen zurücknehmen, die sich unberechtigt in der EU aufhalten.
Nur: Das geschah nicht. Das Verhältnis von Ausreisen oder Abschiebungen zu Ausweisungen (“order to leave”) lag bei den afrikanischen Staatsbürger*innen 2019 EU-weit bei 17,6 % pro Jahr – das ist nur halb so viel wie der Schnitt aller Herkunftsländer. Tatsächlich liegt die Abschiebung der Afrikaner*innen weder im Interesse der Herkunftsstaaten noch im Interesse der betroffenen Personen selbst.
Schon 2012 hatte eine mit Abschiebungen befasste Arbeitsgruppe von Bund und Ländern in Deutschland Gründe dafür aufgelistet: auf Platz eins der Liste: „Pass(ersatzpapier)beschaffung“. Auf Platz zwei: „Kooperationsverhalten der Herkunftsstaaten“. Manche Botschaften würden Pässe nur ausgeben, wenn der Betreffende einwilligt. Sie würden ihre Bürger*innen vor den deutschen Behörden schützen, schreibt die AG Rück, dazu komme Korruption, Willkür, ein fehlendes "politisches Interesse an Rückführungen", manche Länder wollten Deutschland gar Zugeständnisse oder Geld „abpressen“.
Eben diese Haltung vor allem bei afrikanischen Staaten zu durchbrechen, machte sich die EU in den folgenden Jahren zur Aufgabe (siehe Diplomatie, Valletta, Migrationspartnerschaften). „Konkrete und messbare Ergebnisse bei der zügigen Rückführung irregulärer Migranten", forderte der Rat bei seinen Treffen 2016. Liefern die afrikanischen Staaten dies nicht, würden "Engagement und Hilfe angepasst". 2017 kündigte die EU schließlich die "Nutzung aller verfügbaren Hebel". In der Sprachregelung der EU soll das wohl heißen: Kürzungen bei der → Entwicklungszusammenarbeit. Unter anderem um das künftig zu erleichtern, strukturierte die EU ihr Entwicklungsbudget um (see NDICI).
Konkret wollte die EU zweierlei erreichen: Zum einen sollten die afrikanischen Staaten so genannte Rücknahmeabkommen unterschreiben, um die Kooperation bei Abschiebungen zu verbessern. Die Abkommen sollen dafür sorgen, dass die Staaten bei Abschiebungen kooperieren: dass sie Pässe ausstellen, Identitäten bestätigen. Diese Rücknahmeabkommen sind ein völkerrechtliches Kuriosum – eigentlich dürfte es sie gar nicht geben. Denn das Völkerrecht regelt, dass jeder Staat seine eigenen Bürger*innen wieder einreisen lassen muss. Schon im Abkommen von Coutonou hatte die EU im Jahr 2000 den sogenannten AKP-Staaten – also den Staaten Afrikas, des Pazifiks, der Karibik – noch einmal die Zusicherung abgenommen, dass sie alle ihre Bürger zurücknehmen, die sich unberechtigt in der EU aufhalten. Nur: Das geschah nicht.
In ihrem „Rückkehrplan“ vom September 2015 nahmen die EU-Innenminister sich vor, die afrikanischen Staaten zur Unterzeichnung von Rücknahmeabkommen zu drängen. Sie hoffen auf den bevorstehenden Valletta-Gipfel. Schon Jahre zuvor hatte die EU die entsprechenden Verhandlungen aufgenommen. Afrikanische Staaten sollen sich nicht bloß verpflichten, ihre eigenen Bürger*innen zurückzunehmen, sondern auch die von anderen Staaten, die sie im Transit durchquert haben. Vor allem letzteres lehnten sie ab. Viele EU-Staaten aber bestanden darauf, die Drittstaatler*innen einzuschließen. Die Vorteile für die EU lagen dabei auf der Hand: Abschiebungen in die nordafrikanischen Transitstaaten sind viel einfacher, schneller und billiger zu organisieren.
Zudem sollten afrikanische Staaten eine neue Sorte von Abschiebepapieren, sogenannte EU-Laissez-Passers, anerkennen. Der Clou: Die EU-Mitgliedstaaten können diese einfach selbst ausstellen. Wenn Abzuschiebende keinen Pass haben und die Botschaft auch keinen ausstellt, ist das überaus praktisch. Im Dezember 2015 brachte die Kommission den Gesetzentwurf für ein „EU-Reisedokument für illegal aufhältige Drittstaatenangehörige“ ein. Doch das Problem ist: Kein Nicht-EU-Staat erkennt sie an, denn damit würde er ein Stück seiner Souveränität aufgeben – das Recht zu bestimmen, wer einreisen darf. Für einen „Verstoß gegen internationales Recht“ hält die Afrikanische Union gar die Papiere.
2016 lag die Ausreisequote bei den afrikanischen Staatsbürgern bei 17,4 % – sie stieg in den folgenden Jahren also so gut wie nicht an. Die Verhandlungen blieben weitgehend erfolglos. Einzige Ausnahme war Äthiopien (→ Entwicklungspolitik).
Mit dem Land einigte die EU sich darauf im Dezember 2017. Das Abkommen sieht vor, dass die Botschaften Äthiopiens auf Antrag europäischer Ausländerbehörden innerhalb von drei Werktagen Abschiebepapiere ausstellen müssen. Gibt es keinen Pass, können die europäischen Ausländerbehörden dem äthiopischen Geheimdienst – im Abkommen umschrieben als „Nachrichten- und Sicherheitsdienste“ – Dokumente übermitteln, die Rückschlüsse auf die Staatsangehörigkeit zulassen: etwa die Kopie eines abgelaufenen Ausweises. Die Antwort muss dann innerhalb von zwei Wochen erfolgen.
Gibt es solche Dokumente nicht, können die Ausländerbehörden die mutmaßlichen Äthiopier*innen bei der Botschaft zur Befragung vorführen lassen. Die muss die Befragung innerhalb von zwei Wochen durchführen und entscheiden, ob es sich um eine*n Äthiopier*in handelt.
„Auf Antrag“ können die EU-Staaten direkt aus Äthiopien Beamt*innen für „Spezialmissionen“ einfliegen lassen. Diese Möglichkeit will sich die EU vermutlich für den Fall offen halten, dass die Botschaften zu wenige Abschiebepapiere ausstellen. Die Beamt*innen sollen die Abzuschiebenden befragen, um die Staatsangehörigkeit festzustellen. Solche Vereinbarungen sind sehr umstritten.
Der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) hatte Äthiopien im September 2017 in einem Bericht gelobt, weil das Land Fortschritte bei der Bekämpfung von Schleppernetzwerken gemacht habe. Dadurch sei die Zahl irregulär Grenzübertretender, die vom Horn von Afrika nach Europa gelangen, gesunken.
Die „Zusammenarbeit bei der Rückkehr aus der EU“ – bei den Abschiebungen also – sei jedoch „unbefriedigend und die Rückkehrrate ist eine der niedrigsten in der Region“. Das politische „Engagement auf höchster Ebene“ müsse noch in operative Kooperation umgesetzt werden.
Amnesty International sieht die geplante Zusammenarbeit mit dem äthiopischen Geheimdienst NISS bei der Identitsfeststellung mit Sorge. „Innerhalb des letzten Jahres hat Amnesty International immer wieder von Asylverfahren erfahren, in denen die eritreische Staatsangehörigkeit vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angezweifelt wurde“, sagte Franziska Ulm-Düsterhöft, Amnesty-Fachreferentin für Afrika. „Stattdessen wurde davon ausgegangen wurde, dass es sich tatsächlich um äthiopische Staatsangehörige handle.“
In dem EU-Dokument seien keinerlei Kriterien festgelegt werden, wann eine Person für den NISS als äthiopische*r Staatsangehörige*r gilt. Für Ulm-Düsterhöft stellt sich die Frage, wie sichergestellt werde, dass Eritreer*innen, die teils die gleiche Sprache sprechen, „nicht fehlerhaft die äthiopische Staatsangehörigkeit zugesprochen bekommen und nach Äthiopien abgeschoben werden“. Amnesty habe auch grundsätzlich Bedenken, den NISS direkt auf Personen aufmerksam zu machen. „In der Vergangenheit sei der Geheimdienst immer wieder für die Verfolgung und Verhaftung von Regierungskritiker*innen und diverse Menschenrechtsverletzungen bekannt geworden.“ Das Verfahren sehe keinerlei Zusicherung Äthiopiens vor, Menschenrechte der einzelnen Personen zu wahren, die nach Äthiopien rückgeführt werden.
Der Grüne Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz sagte, die Einschätzung einer Staatsangehörigkeit durch einheimische Beamt*innen habe sich bereits in der Vergangenheit als korruptionsanfällig erwiesen. „Es ist völlig unerklärlich warum dieses Verfahren nun wieder zum Einsatz kommen soll.“ Die Gefahr der Rückführung von Eritreer*innen sei besonders heikel. „Es ist nicht auszuschließen, dass unter dem Vorwand diejenigen abschieben zu wollen, die eine falsche Identität angeben, Menschen zurückgeführt werden, die tatsächlich aus der eritreischen Steinzeitdiktatur geflohen sind“, sagte Kekeritz. Die Betroffenen seien dann in Äthiopien staatlicher Willkür ausgeliefert.
Außer Äthiopien hat soweit bekannt kein weiterer Staat auf dem afrikanischen Festland ein solches multilaterales Abkommen mit der EU als ganzer unterzeichnet. Eine Übersicht aller Rücknahmeabkommen gibt es auf der Seite des Forschers Jean Pierre Cassarin, allerdings muss man zunächst darlegen, warum man die Infos will, um hier Zugang zu bekommen.
2018 legte die damalige EU-Kommission deshalb einen Gesetzentwurf für den systematischen Einsatz von Visarestriktionen vor, teilweise ging dieser in die Verordnung über den neuen Visakodex ein, der im Februar 2020 in Kraft trat.
2021 nahm die EU-Kommission eine Bewertung von 39 Staaten vor, die die Rücknahme eigener Staatsbürger*innen regelmäßig verhindern. Der Zeitung Welt zufolge erhalten 13 Staaten die schlechteste Bewertung „mangelhaft“: Irak, Iran, Libyen, Senegal, Somalia, Mali, Gambia, Kamerun, Republik Kongo, Ägypten, Eritrea sowie Äthiopien und Guinea-Bissau. Die EU erwog Restriktionen bei der Vergabe von Visa für den Schengen-Raum. Die Bearbeitungszeit für Visaanträge könnte verlängert oder die Gültigkeitsdauer der ausgestellten Visa verkürzt werden. Die Streichung der Einreiseerlaubnisse war indes nicht geplant – es gehe darum, mit den rücknahmeunwilligen Staaten „einen Dialog zu starten“, sagte die Kommission der Welt. Falls dies gelinge, könnten diesen Ländern Erleichterungen bei den Anträgen gewährt werden: Staatsbürger*innen müssten etwa nur noch zehn Tage auf ein Schengenvisum warten und die Gültigkeit könnte verlängert werden.
„Geförderte Rückkehr“
Seit Jahren gibt es auf nationaler Ebene Anreize für Asylsuchende, teils noch vor ihrer Ablehnung in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Die „geförderte Rückkehr“ für abgelehnte Asylbewerber*innen wird gepriesen als humane Alternative zur Abschiebung. Mit ihr lassen sich Menschen loswerden, die man nicht im Land haben will, ohne dass aufwändige Abschiebungen nötig sind.
Einen umfassenden Überblick bietet das im August 2021 gestartete Portal „Rückkehr-Watch“. „Die Angebote zur vermeintlich freiwilligen Rückkehr erweisen sich in der Asylpraxis als hochproblematisch. Mitunter werden Asylsuchende dazu aufgefordert, „freiwillig“ ihr laufendes Asylverfahren einzustellen und auszureisen“, schreibt darin der Jurist Maximilian Pichl. „Solche Angebote basieren darauf, dass es für sehr viele Geflüchtete schwierig ist, mit einer ordentlichen Rechtsberatung oder guten Asylrechtsanwält*innen in Kontakt zu kommen. Denn selbst bei vermeintlich hoffnungslosen Fällen kann es einer anwaltlichen Vertretung gelingen, mit der Ausschöpfung der rechtsstaatlichen Möglichkeiten ein Bleiberecht zu erwirken.[37]
In Deutschland etwa ist die bekannteste Variante der „geförderten Rückkehr“ das 2017 gestartete Programm „Starthilfe Plus“. In den ersten beiden Jahren des Programms wurde Geflüchteten der Verzicht auf ihre Rechte regelrecht abgekauft: Wer den eigenen Asylantrag gar nicht erst abgab, bekam 1.200 Euro. Wer ausreist, ohne eine Ablehnung gerichtlich überprüfen zu lassen, bekam 800 Euro. Seit 2019, immerhin, ist die Kopplung an den Asylstatus aufgehoben. Doch die Förderung bleibt weniger ein goldener Handschlag als vielmehr ein dürres Handgeld für das Ende vom Traum eines Lebens in Europa. Sie reicht nicht, um im Herkunftsland wieder Fuß zu fassen.Es gibt in Westafrika heute NGOs, die zwischen Migrant*innenen, deren Rückkehr von der IOM – mit europäischem Geld also – gefördert wurde, und deren Familien vermitteln. Denn die meist jungen Leute trauen sich teils nicht zurück in ihre Dörfer, weil sie die Schulden nicht bezahlen können, die sie für die Passage nach Europa aufgenommen haben.
Im April 2021 kündigte auch die EU eine eigene Strategie für die „geförderte Rückkehr“ an. Nach von der Kommission genannten Schätzungen des wissenschaftlichen Dienstes des Europaparlaments kostet eine Abschiebung im Schnitt 3.414 Euro. Bei der freiwilligen Rückkehr sind es dagegen nur rund 560 Euro. Migrant*innen ohne anerkannten Asylstatus sollen „intensiver als bisher ermutigt werden, in ihre Heimatländer zurückzukehren“ und „frühzeitig über die Möglichkeit, freiwillig in ihr Heimatland zurückzukehren, beraten werden“, heißt es darin. Außerdem vorgesehen ist eine Zusammenarbeit mit den Heimatländern, um diese zu überzeugen, die Menschen wiederaufzunehmen und zu integrieren. Frontex soll die Mitgliedstaaten stärker bei freiwilliger Rückkehr unterstützen, einen "Rückkehrkoordinator" schaffen und „Lehrplan für Rückkehr-Berater*innen“ erarbeiten.
Interne Datenbanken: Schengener Informationssystem/Visa Information System/EURODAC
Während innerhalb des Schengen-Gebietes die Personenkontrollen bis auf Stichproben hinter den Landesgrenzen weggefallen sind, werden Personen an den EU-Außengrenzen nach einem einheitlichen Standard kontrolliert. Dazu wurde zunächst das das Schengener Informationssystem (SIS) geschaffen und einheitliche Einreisevoraussetzungen für Drittstaatler*innen festgelegt. Das SIS ist eine zentrale Datenbank, die fast 100 Millionen Einträge umfasst. Neben zur Fahndung ausgeschriebenen Verdächtigen können die Behörden darin auch vermisste Menschen, gestohlene Autos, Waffen oder Ausweispapiere aufnehmen. Die SIS-Infrastruktur wurde 2011 um das Visa-Informationssystem (VIS) erweitert, in dem Informationen über Visa zwischen den Mitgliedsstaaten ausgetauscht werden.
Das VIS besteht aus einer zentralen Datenbank, einer nationalen Schnittstelle in den Schengen-Staaten und einer Infrastruktur zur Kommunikation zwischen beiden. Durch die nationalen Schnittstellen werden Daten zu allen im Schengen-Staat durchgeführten Anträgen, Ausstellungen, Ablehnungen, Annullierungen, Widerrufen und Verlängerungen von Visa durch die zuständigen Behörden in das System eingespeist.
Das VIS umfasst zwei Systeme: Eine zentrale Datenbank sowie ein automatisiertes System zur Identifizierung von Fingerabdrücken (AFIS), welches neue und bereits in der Datenbank aufgenommene Fingerabdrücke vergleicht. Die Hauptdatenbank des VIS befindet sich in einem Rechenzentrum in Straßburg (Frankreich), während ein Backupsystem in St. Johann im Pongau (Österreich) das System sichert. Durch das VIS können Behörden leichter und schneller die Identitäten von Inhaber*innen eines Visums direkt beim Grenzübergang verifizieren und überprüfen. Alle neuen Eingaben in das System sind innerhalb weniger Minuten für alle nationalen Stellen verfügbar.
Das 2003 gestartete EURODAC (European Dactyloscopy) schließlich ist ein Fingerabdruck-Identifizierungssystem für den Abgleich der Fingerabdruckdaten aller Asylbewerber*innen sowie von bestimmten Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen. Der Datenabgleich soll verhindern, dass Personen in mehreren EU-Mitgliedstaaten Asyl beantragen können. EURODAC ist eine der technischen Grundlagen des → Dublin-Systems: „Zum Zwecke der Anwendung des Dubliner Übereinkommens ist es erforderlich, die Identität von Asylbewerbern und Personen festzustellen, die in Verbindung mit dem illegalen Überschreiten der Außengrenzen der Gemeinschaft aufgegriffen werden“, schreibt dazu der Rat. Jeder Mitgliedstaat solle prüfen können, „ob ein Ausländer, der sich illegal in seinem Hoheitsgebiet aufhält, in einem anderen Mitgliedstaat Asyl beantragt hat.“
EURODAC ist eine der vier biometriebasierten Datenbanken der EU, die bald zu einer einzigen Datenbank zusammengelegt werden sollen. Fingerabdrücke von über 2,7 Millionen Asylbewerber*innen europaweit sind in EURODAC laut Angaben der europäischen IT-Agentur EU-LISA Ende 2014 gespeichert, Tendenz steigend. Momentan arbeitet die EU intensiv an einer Zusammenlegung ihrer Datenbanken. Seit Juli 2015 dürfen auch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten sowie Europol für Ermittlungen auf EURODAC zugreifen. Sowieso schon marginalisierte Gruppen werden so im Namen der Terrorbekämpfung unter Generalverdacht gestellt werden.
"Relocation"
Seit 2015 gibt es Programme für die EU-interne Umverteilung von Geflüchteten, die sogenannte Relocation. Dabei werden Asylsuchende aus EU-Mitgliedsstaaten mit stark beanspruchten Asylsystemen – wie Griechenland oder Italien – in andere Mitgliedsstaaten umverteilt und durchlaufen dort das Asylverfahren. Damit soll eine bessere Verteilung der Asylsuchenden innerhalb Europas erreicht werden. Voraussetzung für das Relocation-Verfahren war, dass die Asylsuchenden aus Herkunftsländern stammen, bei denen die durchschnittliche Anerkennungsquote in der EU mindestens 75 % beträgt
2015 hatte die Europäische Kommission zunächst beschlossen, bis 2017 rund 160.000 Geflüchtete aus Italien und Griechenland auf andere EU-Mitgliedstaaten zu verteilen. Überstellt sollten vor allem Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive werden, wie etwa Syrer*innen und Eritreer*innen und besonders Schutzbedürftige (Familien mit Kindern, Frauen, Kranke). Konkrete Zusagen für die Aufnahme gab es von den Mitgliedsstaaten dann für rund 98.000 Menschen. Das 2017 ausgelaufene Programm blieb auch weit dahinter zurück: Lediglich 34.700 Menschen wurden in seinem Rahmen überstellt – etwa 12.600 aus Italien und rund 23.000 aus Griechenland. Die meisten von ihnen gingen nach Deutschland (ca. 11.000 Menschen), Frankreich (5.000) und nach Schweden (3.000). Ungarn und Polen haben hingegen keine einzige asylsuchende Person aus Italien und Griechenland aufgenommen.
Ab 2018 kamen zwei sogenannte „besondere Umverteilungsverfahren“ ("Bootsaufnahmen") hinzu. Dabei handelte es sich um Programme für aus Seenot gerettete Migrant*innen, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat (aktuell Malta und Italien) anlanden durften und auf einen oder mehrere EU-Mitgliedstaaten verteilt wurden. Bei dieser Personengruppe handelt es sich somit ebenfalls um Asylsuchende. Zwischen Sommer 2018 und Oktober 2019 haben sich die Mitgliedstaaten dabei einmalig verpflichtet, etwa 1.200 Geflüchtete aus Italien und Malta aufzunehmen. Tatsächlich überstellt wurden darüber allerdings lediglich 368 Personen.
Infolge der Versuche des ehemaligen italienischen Innenministeriums zwischen 2018 und 2019 die Ankunft von aus Seenot geretteten Personen in italienischen Häfen zu blockieren, wurde im September 2019 in Malta ein EU-ad-hoc-Verteilungsmechanismus beschlossen. Seenotrettungsschiffe und aus Seenot gerettete Menschen durften erst in die Häfen Italiens und Maltas einreisen, wenn sich andere Mitgliedsstaaten zu ihrer Aufnahme bereit erklärt hatten. Mehrere Personen, die von den zivilen Seenotrettungsschiffen Sea-Watch 3, Open Arms und Ocean Viking im Sommer 2019 gerettet wurden, sollten anschließend nach Luxemburg, Frankreich, Finnland, Portugal und Deutschland verteilt werden.
Seit 2018 gibt es einen Verteilmechanismus für Geflüchtete, die im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden. Gemeinsam mit der EU-Grenzsicherungsbehörde Frontex erfasste EASO die Angekommenen biometrisch und registrierte sie in den Datenbanken der Ankunftsstaaten. Die Beamt*innen bestellten Vormünder für unbegleitete Minderjährige und fragen die Angekommenen, ob sie Asyl beantragen wollen. Schließlich erstellten sie Listen mit Vorschlägen, wer in welches Land weitergeschickt werden soll. Auch dafür gab es feste Kriterien: Verwandte in einem der Aufnahmestaaten oder „kulturelle Verbindungen“, etwa Sprachkenntnisse. Kranke, Minderjährige, Alte oder Menschen mit psychischen Schwierigkeiten werden möglichst gleichmäßig aufgeteilt. Das soll verhindern, dass einige Staaten sich Menschen mit „guten Integrationsaussichten“ aussuchen und andere etwa viele Menschen aufnehmen müssen, deren Versorgung aufwendig ist. Die Staaten prüfen dann die Kandidat*innen. Frankreich, Irland und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg (Bamf) schicken dazu eigene Asylbeamt*innen für Interviews in die Hotspots. Luxemburg und Finnland etwa begnügen sich mit einer Videokonferenz. Dazu kommt ein Sicherheitscheck. Danach können die Menschen ihr Asylverfahren im Aufnahmeland durchführen.
Doch wie die NGO borderline-europe in ihrem Bericht „EU ad hoc relocation – A lottery from the Sea to the Hotspots and Back“ schreibt, hielten sich die Staaten „weder an die vereinbarte Frist von vier Wochen, nach denen die Menschen aus den Hotspots in Italien und Malta umverteilt werden sollten, noch folgten die Methoden der jeweiligen Mitgliedsstaaten den gemeinsamen Vereinbarungen oder rechtsstaatlichen Grundlagen. Während Frankreich und Portugal nur Personen aufnahmen, denen sie jeweils einen Schutzstatus gewährten, verzögerte Deutschland den Relocation Prozess. Nach fragwürdigen Sicherheitsüberprüfungen durch den deutschen Verfassungsschutz, dessen Zuständigkeit in Asylverfahren in anderen EU-Staaten ungeklärt ist, durften einige Personen nicht umgesiedelt werden, ohne dass den Personen dafür eine offizielle Begründung mitgeteilt wurde. Darüber hinaus wurden mehrere Asylanträge derjenigen Gäste der Sea-Watch 3 und Ocean Viking, die letztlich von Deutschland aufgenommen wurden, kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt.“
Laut der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hatte die Bundesrepublik seit Juni 2018 insgesamt 1.314 Menschen die Aufnahme in Deutschland versprochen, 913 von ihnen sind tatsächlich eingereist. Auch nach einer Aufnahme in Deutschland ist für die Mittelmeer-Geflüchteten längst nicht sicher, ob sie bleiben können. Wie aus den Zahlen des Innenministeriums auch hervorgeht, wurde nicht einmal ein Fünftel (18,3 %) der vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entschiedenen Asylanträge positiv beschieden. Seit September 2020 hat Deutschland keine aus Seenot geretteten Migrant*innen mehr aufgenommen. Dabei kamen allein in der ersten Hälfte 2021 rund 19.000 Menschen in Italien an.
Projekte der EU zur Migrationskontrolle im Transit/in den Herkunftsregionen
Hinweis: In diesem Unterkapitel sind nur Projekte gelistet, die nicht primär von der EU-Grenzschutzagentur Frontex, sondern von anderen EU-Institutionen betrieben werden. Zu den Frontex-Aktivitäten in den Transit- und Herkunftsregionen siehe die Abschnitte Hoheitliche Frontex-Operationen außerhalb des EU-Territoriums und Nicht-hoheitliche Frontex-Aktivitäten außerhalb der EU.
Brüsseler Migrationsdiplomatie: Rabat-, Khartoum- und Valletta-Prozess, „Migration Compacts“
Schon 2006 begannen 28 Staaten West- und Zentralafrika sich in loser Runde mit Europa zu treffen, um über Migrationspolitik zu sprechen: Der sogenannte Rabat-Prozess. Ausrichter war der in Wien ansässige Think-Tank → ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), der sich zu einer Art diplomatischen Dienstleister für die EU entwickelte. Jahrelang dümpelten die Gespräche ohne nennenswerte Beschlüsse vor sich hin, bis ab 2013 die Lage auf dem Mittelmeer immer dramatischer wurde. Im November 2014 dann trafen sich die mittlerweile 58 Länder des Rabat-Prozesses aus Europa und Afrikas auf einer groß angelegten Konferenz in Rom und verständigten sich auf eine engere Zusammenarbeit in Migrationsfragen. Demnach wollten die Länder unter anderem versuchen, „Menschenschmuggler-Netzwerke entlang der Route zwischen Subsahara-Afrika und Europa zu zerschlagen“. Sie wollten auch „Möglichkeiten legaler Migration erkunden“, den „Schutz für Flüchtlinge ausbauen“ und mittels „besserer Entwicklungshilfe die Situation in den Herkunftsländern verbessern“.
Der damalige italienische Außenminister Paolo Gentiloni sprach von einem „extrem wichtigen Schritt nach vorne im Dialog über Migrationspolitik". Der marokkanische Migrationsminister Anis Birou sagte, dass in allen Ländern das Bewusstsein geschärft werden müsse, dass eine gut organisierte Migration etwas Positives sei.
Die Afrikaner*innen wollten Zugänge, die Europäer*innen Abschottung: Im Grunde war damit das Feld einer Migrationsdiplomatie abgesteckt, in dem die EU in den folgenden Jahren eine unerreichte Betriebsamkeit entfalten und sich mit Milliardenbeträgen Zugeständnisse zu erkaufen versuchen würde.
Als erstes wurde dabei ein ostafrikanisches Pendant zum Rabat-Prozess aus der Taufe gehoben: Der „Khartoum-Prozess“, zwischen der EU und Ägypten, Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Kenia, Somalia, Südsudan und Sudan. Auch hier sollte es Ziel sein „Menschenhandel und Schleusertum einzudämmen“. Den Opfern solle „besserer Schutz vor Ausbeutung und Misshandlungen“ gewährt und nicht zuletzt die „unkontrollierten Migrationsströme“ auf dem Kontinent eingedämmt werden.
Als die Situation auf der sogenannten Balkanroute im folgenden Jahr eskalierte, lud die EU Regierungschefs aus 62 Ländern in Europa und Afrika zu einem Gipfel nach Valletta ein. Die Staatschefs gelobten „gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen die irreguläre Migration“, so steht es in dem 17-seitigen Kommuniqué mit dem schlichten Namen „Action Plan“, das weder das Logo der EU noch jenes der AU trägt. Sonst steht darin wenig: Rücknahmeabkommen? „Wir beschließen weitere Verhandlungen.“ Die „Laissez-Passers“? Nicht erwähnt. Visa für Afrikaner*innen, die diese vehement einfordern? „Innerhalb der bestehenden Gesetze möglich“. Stärkere Grenzkontrollen innerhalb Afrikas? Die EU bietet „Unterstützung bei der Ertüchtigung der nationalen Grenzsicherung“, die afrikanischen Staaten machen keine Zusagen. Kurzum: Es ist ein weitgehend nichtssagendes Papier. In keinem der für die andere Seite entscheidenden Punkte gaben die Afrikaner*innen oder die Europäer*innen nach.
Den hochtönend aufgelegten sogenannten EU-Nothilfefonds für Afrika (→ „EU Trust Funds for Africa“) halten die Afrikaner*innen ohnehin für Etikettenschwindel. Der Löwenanteil des Geldes war zuvor schon längst als Entwicklungshilfe im EU-Haushalt eingestellt. Allzu bereitwillig auf die Wünsche der EU einzugehen, kommt für die afrikanischen Staatschefs nicht infrage: Rücküberweisungen von Migrant*innen aus Europa nach Afrika sind zu wichtig, Abschiebungen beim eigenen Volk unbeliebt.
Die EU versucht, die Verhandlungen des Gipfels in eine praktische Anschluß-Strategie zu gießen, um den Dialog aufrecht zu halten: Den „Joint Valletta Action Plan“ (JVAP), den man sich als eine Art Fusion des Rabat- und Khartoum-Prozesses vorstellen kann. Doch ihr wird gleichzeitig klar, dass der Versuch, ein Abkommen mit einem halben Kontinent zu schließen und so ihr „Flüchtlingsproblem“ zu lösen, nicht glücken wird. Sie verkündet im Juni 2016 eine neue Strategie: Das „New Migration Partnership Framework“, eine Häutung „Joint Valletta Action Plans“ und sucht zunächst sieben Staaten aus, mit denen sie intensiv weiterverhandeln will. Aber nun mit jedem dieser Staaten einzeln: Im Nahen Osten sind das Libanon und Jordanien, wo viele Geflüchtete aus Syrien leben, in Afrika sind es Mali, Nigeria, Niger, Senegal und Äthiopien. Mit ihnen will die Kommission sogenannte → „Migration Compacts“ schließen (nicht zu verwechseln mit dem 2018 in Marokko beschlossenen „Global Compact for Migration“ der UN, auf Deutsch „Globaler Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“). Diese Rahmenverträge mit ausgewählten Transit- und Herkunftsstaaten wurden teils von der EU auch „Migration Partnerships“ genannt, in ihnen ist u.a. von Investitionen, der Rücknahme Abzuschiebender und Hilfe bei der Terrorbekämpfung die Rede – eine Art All-inclusive-Paket der Zusammenarbeit. Die EU versuchte damit vor allem Zugeständnisse bei der Kooperation für Abschiebungen auszuhandeln (→ Return, → Readmission)
Doch die Differenzen blieben. Bis Mitte 2016 gelingt es dem → EEAS auch bei den bilateralen Verhandlungen mit den fünf Compact-Staaten nicht, entscheidende Zugeständnisse zu erringen. Die einzige Ausnahme bildet → Niger. Insgesamt aber reisen nicht mehr Menschen nach Afrika zurück als zuvor – und nicht weniger kommen über das Mittelmeer in Europa an.
Entwicklungspolitik
European Union Emergency Trust Fund Africa (EUTF)
In Valletta präsentierte die EU den EU Emergency Trust Fund for Africa, abgekürzt EUTF, um die „Ursachen irregulärer Migration“ in Afrika zu bekämpfen. Nachdem die Verhandlungen mit den fünf afrikanischen „Migration Compact“/ „Migration Partnerships“ -Staaten nicht sehr erfolgreich waren (Ausnahme: Niger) wird diese Diplomatie-Linie in der Zeit ab 2017 immer weniger verfolgt und geht faktisch in der Politik auf, die mit dem EUTF betrieben wird und mit dem die EU seit dem Valletta-Gipfel versucht, auf breiterer Front gegen die irreguläre Migration auf Afrika vorzugehen.
Für den EUTF wurden bis Mitte 2021 rund 5 Milliarden Euro bereit gestellt. 88 % der Summe stammen aus den Etats der EU-Entwicklungshilfe-Ministerien, etwa 12 % von den EU-Mitgliedstaaten und anderen Geber*innen. Es handelte sich vor allem um eine Neustrukturierung der Entwicklungshilfe – nicht um zusätzliches Geld. Die Mittel kommen 26 afrikanischen Ländern zugute – ausschließlich solchen, von denen aus Europa geographisch für Migrant*innen erreichbar ist. Sie sind in drei Regionen, genannt „Fenster“ aufgeteilt: Horn von Afrika (1.808 Mio. Euro), Nordafrika (900 Mio. Euro) und Sahel/Tschadsee (2.145 Mio. Euro). Die bislang 245 Maßnahmen werden von verschiedenen Implementierungspartner*innen umgesetzt, darunter die Entwicklungsagenturen der EU-Mitgliedstaaten, internationale und lokale NROs sowie internationale Organisationen oder UN-Agenturen. Die Schwerpunktbereiche der Maßnahmen sind „Rückkehr und Reintegration“; „Flüchtlingsmanagement“; „Sicherung von Dokumenten und des Personenstandswesens“; „Bekämpfung des Menschenhandels“; „Stabilisierungsbemühungen am Horn von Afrika“ und „Unterstützung von Migrationsdialogen“. Es geht also ganz klar um Migrations- und nicht um Armutsbekämpfung – ein fundamentaler Paradigmenwechsel bei der Entwicklungszusammenarbeit.
Dass die Mittel auch zur politischen Einflussnahme genutzt werden, zeigt das Beispiel Äthiopien. Es ist bis heute das einzige Land auf dem afrikanischen Festland, das ein Rücknahmeabkommen (siehe Readmission) mit Brüssel unterschrieb. Das war Ende 2017. In jenem Jahr lag die Ausreisequote von Äthiopier*innen in der EU bei 14 %, im Folgejahr bei 25 % – aus EU-Sicht ein voller Erfolg. Unter anderem hatte Äthiopien sich verpflichtet, innerhalb kurzer Frist Reisepapiere auszustellen, wenn europäische Ausländerbehörden Äthiopier*innen abschieben wollen. Genau das hatten die afrikanischen Länder bei einem Gipfel in Abidjan kurz zuvor noch kategorisch abgelehnt. Auf eine Anfrage der EU-Abgeordneten Judith Sargentini erklärte der EU-Rat den „die plötzliche kooperative Haltung Äthiopiens“ Ende 2017 damit, dass die EU mit Äthiopien „mittels der finanziellen Instrumente“ zusammengearbeitet habe, hieß es. Sie hat, soll das heißen, die Zustimmung gekauft.
Im Fall von Äthiopien hieß das: Das Land bekam nach dem Valletta-Gipfel 2015 für kurze Zeit Geld aus dem EUTF. Dann folgte eine lange Pause, fast das ganze Jahr 2017 – solange die Emissäre der EU-Außenkommissarin Federica Mogherini die Abschiebekooperation aushandelten. Ein später geleaktes Dokument zeigt, dass sich EU und äthiopische Unterhändler in einer „stillen Übereinkunft“ am 6. Dezember 2017 auf das Rücknahmeabkommen einigten. Und sofort drehte die EU den Geldhahn auf: Nur sechs Tage später wurden 38 Millionen Euro aus dem EUTF für Äthiopien bewilligt, insgesamt bekam das Land seither über 336 Millionen: Entwicklungshilfe als Lohn für die Migrationskontrolle. Allerdings hatte sich das Land nach der Unterzeichnung des Rücknahmeabkommen keineswegs so willfährig gezeigt, wie die EU gehofft hatte – die Abschiebezahlen sind kaum gestiegen. „Die EU ist frustriert darüber, dass Äthiopien bei der Rückkehr nicht zusammengearbeitet hat, während Äthiopien enttäuscht ist, dass die EU wenig in Bezug auf die legale Migration angeboten hat“, schreibt Clare Castillejo vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik dazu.
Gleichwohl: Die NGO Oxfam kritisiert daher, dass die EU ihre Entwicklungshilfe für afrikanische Staaten immer stärker mit der Verhinderung von Migration verbindet. Der EUTF stelle mehr als eine Milliarde Euro für die Unterbindung von Migration bereit, nur 56 Millionen Euro seien hingegen für die Ausweitung legaler Zugangswege nach Europa oder innerhalb Afrikas vorgesehen. Zudem werde in der EU der Erfolg von Entwicklungsprojekten zunehmend danach bemessen, ob sie Migrationsbewegungen reduzieren – und nicht nach dem Entwicklungsnutzen für die Menschen vor Ort. "Die EU muss damit aufhören, ihre eigenen Werte zu untergraben. Entwicklungszusammenarbeit soll Armut, Ungleichheit und die Folgen des Klimawandels bekämpfen. Sie darf nicht für entwicklungsfremde politische Zwecke eingespannt werden, auf Kosten armer und bedürftiger Menschen", kritisiert Raphael Shilhav, Berater für EU-Migrationspolitik bei Oxfam. Entwicklungsgelder werden im Rahmen des EUTF Afrika laut Oxfam auch zunehmend als Hebel eingesetzt, um politischen Druck auf afrikanische Regierungen auszuüben, damit sie europäischen Forderungen nach einer stärkeren Bekämpfung irregulärer Migration nachkommen. Das führe zu Spannungen zwischen der EU und afrikanischen Regierungen. In mehreren Ländern hätten sich diese Entwicklungen bereits als "kontraproduktiv" erwiesen. Libyen sei das schlimmste Beispiel für eine "kurzsichtige Migrationskooperation" der EU, mit dem Ergebnis, dass Menschenhandel und willkürliche Inhaftierung von Flüchtlingen unter lebensunwürdigen Bedingungen verstärkt würden, erklärte Oxfam. Auch in den Ländern der Sahelzone trage das Ziel, Migration zu verhindern, weder den regelmäßig auftretenden Dürren noch der schlechten Sicherheitslage Rechnung, führte die Hilfsorganisation aus. So seien Gelder dafür verwendet worden, die Bewegungsfreiheit von Menschen einzuschränken, statt für die Anpassung an veränderte Umstände, etwa durch Umsiedlung und Integration an einem anderen Ort.
NDICI und IBMF
Neu ist es in der Entwicklungszusammenarbeit keineswegs, Hilfe an Gegenleistungen zu knüpfen. Doch das Ausmaß, das diese Konditionalität nun annehmen soll, hat es in sich. Für ihren Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 (Mehrjähriger Finanzrahmen/MFR) hat die EU zwei neue Instrumente aufgelegt: Das „Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI)“ mit 79,5 Milliarden Euro und den „Integrated Border Management Fund“ (IBMF) mit 16 Milliarden Euro. Im NDICI werden sieben bisher separate Instrumente und Fonds, darunter die zwei großen Entwicklungshilfetöpfe, zusammengefasst. Auch die Instrumente für Demokratie und Menschenrechte sowie für Stabilität und Frieden sollen im NDICI aufgehen. Die Länder in Afrika südlich der Sahara, die die EU nicht zuletzt wegen der von dorther kommenden Migrant*innen und Flüchtlinge im Blick hat, sollen mit mindestens 32 Milliarden Euro den Löwenanteil aus dem NDICI erhalten. Der alte Haushalt sei zu unflexibel für „Herausforderungen wie die Migrations- und Flüchtlingskrise im Jahr 2015“ gewesen, hatte der alte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärt. Die neuen Budgetpläne seien eine „ehrliche Antwort auf die Wirklichkeiten unserer Zeit“.
Und das bedeutet: Für Entwicklungshilfe ist künftig kein eigenes Budget mehr vorgesehen – der EU-Entwicklungsfonds EDF verschwindet. Ziele der Entwicklungszusammenarbeit dürften in den Hintergrund treten, die eigenen politischen Interessen bekommen Vorrang. Mit dem NDICI sollen Hilfen wie die Boote für Grenzschützer*innen außerhalb der EU künftig unkompliziert von Brüssel finanziert werden können – mit Geldern für Entwicklungshilfe wäre das nicht zulässig. Entwicklungsgelder dürften in Zukunft weniger den ärmsten und bedürftigsten Ländern zugutekommen als viel mehr strategisch relevanten Ländern, die bereit sind, an der Migrationsabwehr mitzuwirken.
Parallel dazu hat die zwei bestehende Grenzschutzfonds im „Integrated Border Management Fund“ (IBMF) zusammengefasst. Schon bislang wurden aus diesen Haushalten Kameras, Radar, Ferngläser oder Drohnen bezahlt – allerdings für die Grenzschützer*innen der EU-Staaten selbst. Drittstaaten können in Zukunft direkt Geld aus dem Grenzschutzfonds bekommen.
Supranationale Technische Ansätze
Biometrics, Datenbanken, Projekt „MIDAS“
Moderne Reisedokumente haben einen Mikrochip eingebaut, auf dem biometrische Merkmale der Träger*innen gespeichert werden. Fingerabdrücke, Gesichtsform, ein Scan der Iris – bald sollen diese Informationen zentral gespeichert und abgleichbar sein. Über 7.000 Menschen wurden laut Frontex im Jahr 2020 bei der Einreise in die EU mit gefälschten oder fremden Reisedokumenten erwischt. hat die Identitätsfeststellung von Asylsuchenden in ihrer jährlichen Risikoanalyse als eine ihrer „größten Herausforderungen“ bezeichnet. „Sichere Reise- und Identitätsdokumente“ seien von „entscheidender Bedeutung [...], wenn die Identität einer Person zweifelsfrei festgestellt werden muss“. Biometrische Erkennungsverfahren sind eine wesentliche Voraussetzung für schnelle Abschiebungen.
Das liegt auch daran, dass viele Migrant*innen sich nicht ausweisen können oder mit gefälschten oder fremden Pässen kommen. Damit lässt sich nicht feststellen, in welches Land man sie abschieben kann. In Deutschland lag die Quote der Asylverfahren ohne jegliche Identitätsdokumente je nach Herkunftsland zwischen 2 % (Venezuela) und 98 % (Niger). Und fehlende Identitätsnachweise bei Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtigen gelten bei Innenbehörden als das bedeutendste Problem bei Abschiebungen. Besonders „schwierig“ gestalte sich die Abschiebung in „Länder ohne funktionierendes Meldesystem“, wird in einer 2013 vom BAMF herausgegebenen Studie problematisiert. Eine wegen fehlender Papiere um ein Jahr verzögerte Abschiebung kostet rund 12.000 Euro.
Auf dem Valletta-Gipfel im November 2015 hat die EU deswegen mit über 30 afrikanischen Staaten einen Aktionsplan beschlossen, in dem weitreichende Unterstützungsmaßnahmen für die „Modernisierung“ von Melderegistern und sicheren Ausweisdokumenten angekündigt wurden – biometrische Entwicklungshilfe sozusagen.
In Westafrika hat die EU fünf Millionen Euro in die Entwicklung eines Informationssystems für Westafrika, WAPIS, gesteckt. Die Idee: Bis zu 17 Staaten zwischen Mauretanien und Nigeria sollen künftig die im Zuge von Polizeiermittlungen gesammelten Fingerabdrücke auf einer zentralen Datenbank speichern und diese Interpol zugänglich machen. Damit sind die Daten auch in Europa abrufbar. In Ghana, Mali, Niger und Benin laufen seit 2015 Pilotprojekte. Das System ist auch für Grenzkontrollen vorgesehen und soll helfen, gefälschte Dokumente zu identifizieren. Damit rückt ein Massenabgleich von Daten papierloser afrikanischer Migrant*innen für Abschiebezwecke in greifbare Nähe.
Dass es sich dabei nicht um wilde Fantasien von Datenschützer*innen handelt, hat der deutsche Innenminister de Maizière Anfang 2016 auf seiner Maghreb-Reise bewiesen. Marokko habe einem biometrischen Datenabgleich für Abschiebungen bereits zugestimmt, verkündete er. Etwa zwei Wochen später veröffentlicht Veridos, ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Bundesdruckerei GmbH und von Giesecke& Devrient (G&D) mit Sitz in München, eine Pressemitteilung, aus der hervorgeht, dass es von Marokko mit der „Entwicklung und Umsetzung eines nationalen Grenzkontrollsystems“ beauftragt wurde. Der Auftrag umfasst biometrische Scanner, Passlesegeräte, automatisierte Kontrollschleusen und Server für 1600 Kontrollposten.
Der größte Markt in Afrika ist Nigeria, Afrikas bevölkerungsreichstes Land, das als Drehkreuz für Passfälscher gilt. Im März 2015 unterzeichnete die EU mit dem 182-Millionen-Einwohner*innen-Staat ein „Mobilitätsabkommen“, das vorsieht, die Identitätsdokumente mit dem Einsatz von biometrischer Technologie sicherer zu gestalten. Im Februar 2016 wurde in einem internen Strategiepapier der EU-Kommission der Ausbau eines Melderegisters mit biometrischer Erfassung vorgeschlagen. Sieben Monate später stellte Nigerias Präsident eine neue eID vor. Der Clou: Der amerikanische Konzern Mastercard hat die IDs zu Bankkarten gemacht und somit potenziell 100 Millionen Nigerianer*innen als neue Kunden langfristig an sich gebunden. Gedruckt werden sie vom niederländischen Chipkartenhersteller Gemalto. Der Absatzmarkt ist in Afrika schier grenzenlos.
Seit 2018 unterstützt die Abteilung Immigration and Border Management (IBM) der Internationalen Organisation für Migration (IOM) afrikanische Staaten bei der biometrischen Erfassung von Einreisenden. Dazu hat die IOM eine Software namens MIDAS entwickelt: Das Migrations-Informations- und Datenanalyse-System. Darin werden die Daten aller Personen gespeichert, die über offizielle Grenzübergänge ins Land kommen. In Niger wurde die Software Anfang 2019 auf die Polizeicomputer an den Grenzübergängen aufgespielt, wie der Spiegel berichtete. Zuvor, im August 2018, hatte die EU für die Regierung Nigers eine Machbarkeitsstudie finanziert, um zu prüfen, inwieweit man das Midas-System hier anwenden könnte. Niger solle nun „zur Schaltzentrale einer einzigartigen IT-Zusammenarbeit ausgebaut werden“, so der Spiegel. „Riesige Mengen an Metadaten sollen hier gesammelt, analysiert und geteilt werden. Auch EU-Behörden können theoretisch auf diese Daten zugreifen – das ist das Besondere und rechtlich Umstrittene an diesem Projekt.“ Die IOM versichert zwar, die über Midas erhobenen Daten blieben allein bei den Nationalstaaten. Doch sie werden zentral auf einem Server im Polizeihauptquartier in der Hauptstadt Niamey gespeichert – und genau dort hat Frontex im November 2018 ein eigenes Büro eröffnet: die "Risiko-Analyse-Zelle". Es ist die erste Niederlassung der EU-Grenzschutzagentur außerhalb Europas. Sie ist Teil einer größeren Allianz europäischer und afrikanischer Sicherheitsbehörden: der Africa-Frontex Intelligence Community. Die daran beteiligten afrikanischen Staaten verpflichten sich, Strukturdaten weiterzugeben. Dazu gehören Zahlen zu regulären Grenzübertritten, Einreiseverweigerungen, Schmuggel, Dokumentenfälschung oder Drogendelikten. Sie weisen darauf hin, wo sich Migrationsströme in Afrika entwickeln und wo sich Schleusernetzwerke bilden. Dieses Wissen nutzt Frontex für Risiko-Analysen und teilt es mit den EU-Staaten, so der Spiegel weiter.
Biometrie-Register Senegal & Côte d'Ivoire
Im Rahmen des EUTF startete die EU 2018 zwei Programme zur Schaffung nationaler Biometrieregister in Westafrika. In Senegal wurde dazu 2017 ein Projekt namens PAMEC (Programme d'appui au renforcement du système d’information de l’état civil et à la création d’un fichier national d’identité biométrique/Unterstützungsprogramm zur Stärkung des Personenstandsinformationssystems und zur Schaffung einer nationalen biometrischen Identitätsdatei) mit 28 Millionenm Euro ausgestattet. In der Elfenbeinküste fließen seit 2020 zunächst rund fünf Millionen Euro in das Projekt als „Appui à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’état civil et de l’identification de Côte d’Ivoire“(Unterstützung bei der Umsetzung der nationalen Strategie für Personenstand und Identifizierung in Côte d'Ivoire).
Ziel ist der Aufbau einer jeweiligen nationalen biometrischen Identitätsdatei. Das Projekt wurde Ende 2020 von der NGO Privacy International umfassend untersucht. Demnach streben die EU-Behörden an, in Zukunft auf diese Identifizierungssysteme zugreifen zu können, um den Abschiebeprozess vom europäischen Kontinent zu beschleunigen. In Côte d'Ivoire heißt es in der Projektbeschreibung ausdrücklich, dass es zur Unterstützung der Identifizierung von Ivorer*innen, die sich irregulär in Europa aufhalten, und zur leichteren Organisation ihrer Rückkehr eingesetzt werden soll. Die EU hat vorgeschlagen, in den Staaten eine Volkszählung durchzuführen, um alle Daten der Bevölkerung, einschließlich biometrischer Daten, zu erfassen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, in das neue System Daten aus anderen Datenbanken, einschließlich des derzeitigen nationalen ID-Systems und des Passsystems, einzubeziehen.
In beiden Fällen werden die Projekte von → CIVIPOL umgesetzt, im Senegal ist zusätzlich die belgische Entwicklungsagentur ENABEL dabei.[38]
Satellitenüberwachung
EUROSUR
Seit 2013 geht die EU mit dem Grenzüberwachungssystem Eurosur (European Border Surveillance System) gegen illegalisierte Einwanderung vor. Dabei werden Drohnen, Aufklärungsgeräte, Offshore-Sensoren, hochauflösende Kameras und Satellitensuchsysteme eingesetzt. Das System überwacht vor allem den Luftraum über dem Mittelmeer. Die EU-Länder teilen über das Kommunikationssystem Informationen über verdächtige Bewegungen an den Außengrenzen und auf See. Eurosur läuft unter der Federführung der EU-Grenzschutzagentur Frontex und wurde 2019 in Frontex eingegliedert. Das System ist eine Entwicklung von Frontex und dient primär dem Informationsaustausch und der Kooperation nationaler Grenzbehörden. Boote entlang der Küsten, Lastwagen in der Wüste oder wandernde Menschen – all das kann im Frontex-Hauptquartier in Warschau live auf dem Monitor mitverfolgt werden. Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung geht von mindestens 874 Millionen Euro Kosten aus. 2018 wurde Libyen an Eurosur angebunden – eine zivile Grenzmission in Libyen bekam eine „maßgeschneiderte Software-Anwendung, die auch den Zugang zu Satellitenbildern ermöglicht". So soll Libyen sich über Eurosur mit den Koordinierungsstellen in Italien, Malta, Griechenland, Zypern, Frankreich, Spanien und Portugal verbinden können.
Seahorse Mediterranean
2014 schlossen sich die EU-Anrainerstaaten des Mittelmeers – Portugal, Frankreich, Italien, Malta, Griechenland und Zypern, angeführt von Spanien – zum Netzwerk "Seahorse Mediterranean" zusammen. Sie errichteten ein satellitengestütztes Netzwerk zur Kommunikation von Militärs und Grenzpolizeien. Wie der Publizist Matthias Monroy beschreibt, ermöglicht die Kommunikationsinfrastruktur den Austausch von Berichten über maritime Zwischenfälle, darunter Such- und Rettungseinsätze oder andere kritische Ereignisse. "Seahorse Mediterranean" folgt demnach dem Projekt "Seahorse Atlantic", das die spanische Guardia Civil zu Beginn des Jahrtausends ins Leben gerufen hat. Daran sind auch die westafrikanischen Staaten Mauretanien, Marokko, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau und Kap Verde beteiligt, so Monroy.
Die nationalen Koordinierungszentren der Länder werden dazu an ein „Mediterranean Border Cooperation Centre“ (MEBOCC) angeschlossen,[39] das im nationalen italienischen Koordinierungszentrum für die Grenzüberwachung angesiedelt ist, wie eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Lösing und Cornelia Ernst ergab. In „Seahorse Mediterranean“ können demnach Informationen von Schiffsmeldesystemen, Satelliten, bemannten und unbemannten Überwachungsflugzeugen sowie anderen Sensoren ausgetauscht werden. Auch die sogenannte libysche Küstenwache, die zur Marine wurde, an „Seahorse Mediterranean“ angeschlossen und so in Echtzeit-Informationen aus europäischen Überwachungssystemen oder Missionen erhalten kann.
Satellitengestützte maritime Situationsanalyse Frontex
2019 vergab → Frontex einen Auftrag über 1,5 Mio. Euro für eine sogenannte „Satellitenfunkfrequenz-Emitter-Detektion für die maritime Situationsanalyse“. Damit sollen aus dem All Signale von maritimen Radaren, Schiffstranspondern oder Satellitentelefonen erkannt und lokalisiert werden. So sollen Schiffe oder Menschen, die Satellitentelefone benutzen, im Mittelmeer besser geortet werden können. Der Auftrag ging ohne Ausschreibung an das US-amerikanische Unternehmen → HawkEye360. Zu den Investoren von HawkEye 360 zählen das US-amerikanische Medienunternehmen Advance, das europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus und der internationale Datenanalysekonzern Esri. Im Juli 2021 hat HawkEye 360 die letzten der insgesamt 20 aktiven Satelliten entsandt.[40]
Frontex begründete dies damit, dass „die durchgeführte Marktforschung eindeutig ergeben hat, dass es derzeit nur ein Unternehmen gibt, das in der Lage ist, die gewünschten Dienste zu erbringen". HawkEye360, dessen Vorstand und Investor*innen sich aus einigen der weltweit größten Rüstungsunternehmen zusammensetzen und von hochrangigen Mitgliedern des US-Militärs und des Geheimdienstes beraten werden, hat seine ersten Satelliten mit Hilfe von Elon Musks SpaceX im Jahr 2018 gestartet und soll seine "Erfassungskapazität" in den kommenden Jahren mit mehreren Satelliten erweitern.
Im Oktober 2020 veröffentlichte Frontex eine Ausschreibung über 5 Millionen Euro für den Zugang zu denselben Diensten für ein Jahr zahlen zu wollen. Die Daten sollen von Frontex-Analyseabteilung genutzt werden und über → EUROSUR an verschiedene Stellen weitergeleitet werden.
Auf Anfrage der Organisation Privacy International erklärte Frontex, dass sich das Projekt immer noch in der Pilotphase befände und keine Kommunikation abgefangen würde. Es unterliegt allerdings der Geheimhaltungspflicht und die Agentur gibt deshalb keine weiteren Informationen preis.
Militärische Projekte/Kooperationen mit Migrationsbezug
Unterstützung der „G5 Sahel Joint Force“-Militärtruppe im Sahel
2014 gründeten Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad den Staatenbund G5 Sahel zur „Koordination der Armutsbekämpfung, Infrastrukturausbau, Landwirtschaft und Sicherheit“. 2017 beschlossen sie den Aufbau einer gemeinsamen militärischen Spezialtruppe um grenzübergreifend den Terrorismus zu bekämpfen. Die sogenannte G5-Sahel-Joint Force sollte verhindern, dass sich dschihadistische Gruppierungen in der Region weiter verankerten und von dort aus Terroranschläge planten. Im April 2017 hat der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union das strategische Einsatzkonzept gebilligt und mit Resolution 2359 (2017) hat schließlich auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Einrichtung der Einsatztruppe begrüßt.
5.000 Soldat*innen und Polizist*innen wurden dazu unter ein gemeinsames Oberkommando gestellt. Sie verteilen sich auf sieben Bataillone. Geführt werden sie von einem in Mali (Sevaré) stationierten gemeinsamen Hauptquartier und drei Regionalkommandos (West, Central und East), deren Fokus die drei zwischenstaatlichen Grenzen auf den Nord-Süd-Linien zwischen Mauretanien und Mali, zwischen Mali, Niger und Burkina Faso sowie zwischen Niger und Tschad sind. Die geschätzten Gesamtkosten der G5 Sahel Joint Force sollen 432 Millionen US-Dollar betragen.
2017 kündigte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian an, dass das französische Militär aus der Opération Barkhane heraus mit G5 Sahel zusammenarbeiten werde. Die G5-Sahel-Staaten haben für den Aufbau der Truppe je 10 Millionen US-Dollar bereitgestellt, die EU bislang 115 Millionen Euro aus ihrer so genannten Africa Peace Facility für Infrastruktur, Ausrüstung und Ausbildung. Die EU hat zur Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Sahelzone die Regionalisierung ihrer Missionen der „Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger und EUTM Mali beschlossen. Der regionalen Koordinierungszelle gehören Expert*innen für innere Sicherheit und Verteidigung der G5-Sahel-Länder an.
Weiterhin bekam die G5 Sahel Joint Force Fahrzeuge und Kommunikationsausrüstung von Frankreich. Deutschland unterstützt bei den Infrastrukturmaßnahmen den Aufbau des Regionalkommandos im nigrischen Niamey, liefert Ausstattung für die G5-Verteidigungsakademie in Mauretanien und finanziert aus Mitteln der Ertüchtigungsinitiative den Aufbau eines regionalen Ausbildungsnetzwerks.
Der Aufbau der Truppe sollte in erster Linie dem Kampf gegen dschihadistische Gruppen dienen. Allerdings ist ihre Mission seitdem die EU den Löwenanteil der Kosten trägt etwas weiter gefasst. Im November 2017 stellte die damalige EU-Außenkommissarin Federica Mogherini klar, dass die EU die Truppe unterstützt und dabei das Ziel der „Bekämpfung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des Menschenhandels in und durch die Sahelzone“ verfolgt. Die G5-Soldaten sollen also auch die Schlepper jagen – und tun das auch, unter anderem in derDurchsetzung des → „Loi 2015/36“ genannten Gesetzes zur Kriminalisierung des Migrant*innentransports durch Niger. Auch die deutsche Bundesregierung erklärte 2018 sie erwarte durch die Aktivitäten der G5-Truppe „Synergien“ mit verschiedenen Projekten zum Grenzmanagement in der ECOWAS-Region, namentlich den GiZ-Projekten „Integriertes Management von Grenzräumen in Burkina Faso“, „Grenzmanagement in Afrika“ und „Polizeiprogramm Afrika“.[41]
Die G5-Truppe hat ab 2018 immer öfter schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. Seit Ende 2019 haben Human Rights Watch, die Vereinten Nationen und andere mehr als 600 ungesetzliche Tötungen durch die Sicherheitskräfte von Burkina Faso, Mali und Niger bei Antiterroreinsätzen dokumentiert.Versprochene Untersuchungen dieser und zahlreicher anderer mutmaßlicher Übergriffe haben den Opfern und ihren Familien keine Gerechtigkeit gebracht.
EU-Militäroperation „Irini“ im zentralen Mittelmeer
Im Juni 2015 startete die EU eine Militäroperation namens EUNAVFOR MED (European Union Naval Force – Mediterranean), um Schlepper im zentralen Mittelmeer zu bekämpfen. Geplant war, auch auf libyschem Territorium gegen die Schlepper vorzugehen. Das scheiterte jedoch am Widerstand sowohl des libyschen Parlaments in Tobruk als auch der libyschen Zentralregierung unter Ministerpräsident Fayiz as-Sarradsch. Die im Oktober 2015 in EUNAVFOR MED Operation SOPHIA umbenannte Mission beschränkte sich deshalb auf die Ausbildung der → libyschen Küstenwache sowie Patrouillen außerhalb der libyschen Territorialgewässer. An der Operation SOPHIA nehmen 25 EU-Mitgliedstaaten mit militärischem Gerät oder Personal teil. Hin und wieder nahmen die an SOPHIA beteiligten Militärschiffe auch Menschen in Seenot auf – teils hatten sie diese selbst gerettet, teils von NGO-Schiffen übernommen. In den fünf Jahren summierte sich die Zahl auf 44.916. Das sind lediglich rund 9 % der Menschen, die in diesem Zeitraum insgesamt in diesem Meeresgebiet gerettet wurden, die meisten hatten private NGOs und die italienische Küstenwache gerettet. Gleichwohl versuchte die EU immer wieder, die Operation SOPHIA als „Seenotrettungsoperation“ darzustellen. Innerhalb der EU kam es zum Streit darüber, was mit den Schiffbrüchigen geschehen sollte, die die Militärschiffe der Operation SOPHIA retteten. Zudem fürchteten einige Staaten, die Operation würde mehr „Flüchtlinge anlocken“. Ab April 2019 war die EU deshalb nicht mehr mit Schiffen im Rahmen von Sophia im Einsatz, sondern beschränkt sich auf die Ausbildung der sogenannten libyschen Küstenwache. Das Mandat wurde im September 2019 ein letztes Mal bis zum 31. März 2020 verlängert und lief danach aus.
Im Februar 2020 legte der → Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) einen Vorschlag vor, um die Mission erneut mit Schiffen auszustatten. Ihre Kernaufgabe sollte jedoch die Überwachung des Waffenembargos sein. Die Ausbildung der sogenannten libyschen Küstenwache und die Schleuserbekämpfung sollten dann zu „Nebenaufgaben“ werden. In einem Papier des EEAS hieß es, die Schiffe könnten „in den Bereichen eingesetzt werden, die für die Umsetzung des Waffenembargos am wichtigsten sind“ – also im östlichen Teil des Einsatzgebiets oder „mindestens 100 km vor der libyschen Küste“. Denn dort, so heißt es in dem Papier wörtlich, seien die „Chancen, Rettungsaktionen durchzuführen, geringer“. Tatsächlich legen die Flüchtlingsboote meist im westlichen Teil der Landesküste ab – und geraten meist schon in Seenot, wenn sie näher als 100 Kilometer von der Küste entfernt sind. So hoffte die EU, dass die Militärs nicht mit der Rettung von Menschenleben behelligt werden.
Dem Vorschlag folgend beschlossen die Außenminister*innen im März 2020, das schon 2011 beschlossene UN-Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen und dafür die Militäroperation „Irini“ als Nachfolge von Sophia einzusetzen. Mit Flugzeugen, Satelliten und Schiffe sollen des Waffenschmuggels nach Libyen verdächtige Schiffe entdeckt, angehalten und durchsucht werden. Weitere Aufgaben der Mission sind das Überwachen und Sammeln von Informationen über illegale Exporte von Öl und Erdölprodukten aus Libyen.
Zudem setzt Irini die von Sophia begonnene Unterstützung der sogenannten libyschen Küstenwache und Marine fort. Schließlich sammelt die Operation Informationen über die Aktivitäten von Schleppern und gibt diese an die europäischen Polizeibehörden weiter.
Auf Druck Italiens und anderer Mitgliedstaaten wurde das Einsatzgebiet aber weiter nach Osten verlegt als bei Sophia und befindet sich nun abseits gängiger Migrationsrouten.
Der Einsatz startete am 4. Mai 2020. Mitte 2021 beteiligten sich sieben europäische Staaten mit rund 1.000 Soldat*innen sowie Zivilpersonal an Irini. Im Einsatz waren zwei Schiffe aus Griechenland und Italien sowie je ein Flugzeug aus Frankreich, Italien, Polen und Griechenland sowie eine Drohne aus Italien.[42] Die Operationsführung wechselt halbjährlich zwischen Italien und Griechenland. Das operative Hauptquartier liegt in Rom.
Das Einsatzgebiet von Irini liegt auf Hoher See südlich Siziliens und außerhalb der Küstenmeere Libyens und Tunesiens. Hinzu kommen der Luftraum über diesen Gebieten sowie angrenzende Seegebiete, die zur Umleitung und Übergabe von Schiffen in einen europäischen Hafen benutzt werden. Davon ausgenommen sind Malta sowie das umschließende Seegebiet innerhalb von 15 Seemeilen. Das Operationsgebiet entspricht ungefähr der Größe Deutschlands. Das EU-Mandat für die Operation Irini läuft vorerst bis zum 30. März 2023.[43]
Die Seenotrettung ist nicht ausdrücklich Teil des Irini-Mandats. Wie alle Schiffe auf See sind aber auch die Einsatzkräfte der EU-Mission verpflichtet, Menschen in Seenot Hilfe zu leisten. Im März 2021 gab die EU-Kommission bekannt, dass die Mission Irini in den ersten zehn Monaten des Einsatzes keine Geflüchteten aus Seenot gerettet habe.
„Schlüsselstaaten“: Zivile Sicherheitsprojekte/Kooperationen der EU mit Migrationsbezug in strategisch wichtigen Partnerstaaten
Der „EU-Türkei-Deal“
Offiziell heißt sie "Erklärung EU-Türkei", bekannt ist sie als "EU-Türkei-Deal". Es handelt sich um eine Vereinbarung zwischen der Republik Türkei und der EU vom 18. März 2016. Sie wurde abgeschlossen, um eine Unterbindung oder zumindest eine Reduzierung der Fluchtbewegung über die Türkei in die Ägäis zu erreichen, in deren Folge der medial und politisch oft als „Flüchtlingskrise“ bezeichnete Sommer der Migration in Europa von 2015 ausgelöst wurde.
Darin erklärte sich die Türkei zur Rücknahme der irregulär auf den griechischen Inseln ankommenden Menschen bereit. Für jede*n Syrer*in, der*die auf diesem Weg in die Türkei zurückgeführt wird, erklärten die EU-Mitgliedsstaaten sich wiederum bereit, eine*n andere*n schutzberechtigte*n Syrer*in aus der Türkei aufzunehmen (sogenannter "1:1-Mechanismus"). Darüber hinaus sichert die EU für die Versorgung der Geflüchteten in der Türkei finanzielle Unterstützung von zunächst drei Milliarden Euro zu, die 2018 mit einer weiteren Tranche von drei Milliarden Euro fortgeführt wurde. Außerdem umfasst die Zusicherung für ein verstärktes Vorgehen der Türkei gegen Schleuser. Hintergrund ist, dass die Türkei mehr geflüchtete Menschen aufgenommen hat als jedes andere Land der Welt: Fast vier Millionen, davon rund 3,6 Millionen aus Syrien. Diese Menschen sollten nach dem Willen der EU dort bleiben.
Für Deutschland und die EU ist das im März 2016 in Kraft getretene Abkommen mit der Türkei ein besonders gelungenes Beispiel für eine Maßnahme gegen irreguläre Migration. Schließlich kamen seither weniger Menschen irregulär in Griechenland an: 2016 waren es rund 177.000, 2021 von Januar bis August nur noch rund 4.500.
Doch der moralische Preis für den Pakt ist entsetzlich. Tatsächlich hatten die meisten Menschen, die die Türkei verlassen wollten, dies bereits 2015 getan – vor Inkrafttreten des Abkommens. Sie wurden nicht von Europa angelockt, weil dessen Grenzen damals offen waren – das waren sie nicht –, sondern weil die Versorgung in der Türkei zusammenbrach: Die Hilfsorganisationen hatten so wenig Geld, dass sie nur noch Lebensmittelrationen für 0,50 US-Dollar pro Tag ausgeben konnten. Wer trotzdem blieb, hatte Gründe: einen Job, hohes Alter, Krankheit, Kinder, kein Geld für die Schlepper, keine Kontakte in Europa, das Bedürfnis, nahe an Syrien zu bleiben. Das Vorgehen der türkischen Armee gegen die Schlepper als Folge des EU-Deals war ein Faktor für den Rückgang der Ankünfte in Griechenland. Aber keineswegs der einzige. Und obwohl die EU bis heute rund sechs Milliarden Euro für die Versorgung der Geflücheten bewilligt hat, leben die rund vier Millionen Geflüchtete dort größtenteils in großer Not: Der Großteil des Geldes aus dem EU-Türkei-Deal fließt über das Europäische Amt für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (DG ECHO) an einen Zusammenschluss von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond. Diese haben ein soziales Sicherheitsnetz aufgebaut, aus dem rund 1,8 Millionen in der Türkei lebende Geflüchtete – also nicht einmal die Hälfte die im Land lebenden – humanitäre Unterstützung in Form von Bargeld erhalten: Das Emergency Social Safety Net (ESSN). Es ist einerseits das größte humanitäre Programm in der Geschichte der EU. Die ausgewählten Flüchtlingsfamilien erhalten allerdings derzeit monatlich nur 155 Türkische Lira (ca. 16 Euro) pro Familienmitglied. Das Geld wird in Form einer monatlich aufgeladenen Bankkarte ausgegeben.
16 Euro pro Person im Monat – das ist deutlich weniger als die von der Weltbank festgelegte Definition für „extreme Armut“. Zwischen dem Inkrafttreten des Deals im März 2016 und Mitte 2021 sind auch wegen dieser existenziellen Not rund 150.000 Flüchtlinge auf griechischen Inseln angekommen. Im selben Zeitraum sind in der Ägäis rund 520 Migrant*innen und Flüchtlinge ertrunken.
Den Angekommenen verweigert Griechenland meist die Weiterreise auf das Festland. So müssen sie in überfüllten → Lagern ausharren. Die EU hat dazu – für die Presse meist nicht zugängliche – → „Hotspots“ genannte Registrierungszentren eingerichtet. Im März 2017 tauchten Fotos aus dem Inneren des „Hotspots“ auf der Insel Chios auf. Sie zeigen Käfige, die an Tierverschläge erinnern. Nach Protesten der Insassen brachen im Internierungslager Moria auf Lesbos immer wieder Brände aus, bis es im September 2016 vollkommen abbrannte.
Nach einem Bericht der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) herrschte in den Lagern auf den Inseln seit spätestens 2017 ein „psychosozialer Notstand“. 95 % der seit Ende 2016 auf Samos und Lesbos angekommenen Menschen seien Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, meist aus Syrien oder dem Irak. Neuankömmlinge in den Lagern müssten teils auf Pappkartons auf dem Boden schlafen. Selbstmordversuche, Selbstverletzungen oder psychotische Erkrankungen hätten im Sommer 2017 um 50 % gegenüber den vorigen drei Monaten zugenommen. Auch Schwerkranke würden interniert, wenn ihr Asylantrag abgelehnt werde, hieß es in dem Bericht.
Ein EU-internes Umverteilungsprogramm hatte vorgesehen, dass insgesamt 63.000 Menschen Griechenland in andere EU-Staaten umgesiedelt werden (→ Relocation). Doch diese hielten sich nicht daran. Bis zum Mai 2018 konnten nur knapp 22.000 Flüchtlinge aus Griechenland in andere EU-Staaten ausreisen.
Unmittelbar nachdem sich die Türkei mit der EU geeinigt hatte, begann sie, die 911 Kilometer lange Grenze nach Syrien abzuriegeln. Im Juni 2019 war der Bau fertig. Die Kosten dafür werden auf zwei Milliarden Euro geschätzt. Die Anlage besteht aus Zäunen und mobilen, sieben Tonnen schweren Betonblöcken, oben mit NATO-Draht als Abschluss, drei Meter hoch, zwei Meter breit, radar- und drohnenüberwacht. Private Sicherheitsfirmen bewachen den Zaun.[44] Nur Schwerverletzte und ihre Angehörigen lässt die Türkei noch einreisen – „white door“ heißt das. Eine konkrete Folge des Deals war also, dass die Menschen vor dem Krieg, der in Städten wie Ghouta, Aleppo und Afrin tobte, nicht ins Nachbarland Türkei fliehen konnten.
Ausbildung der sogenannten libyschen Küstenwache
Die EU begann 2016 mit Schulungen für die im Wesentlichen von Italien initiierte sogenannte libysche Küstenwache, die zunächst im Rahmen der Operation Sophia durchgeführt wurden. Der EU-Rat vereinbarte im Februar 2017, der „Ausbildung, Ausrüstung und sonstiger Unterstützung“ Libyens „weitere Priorität“ einzuräumen, wobei „die libysche Küstenwache und Marine sowie andere einschlägige legitime libysche Stellen Vorrang haben“.[45] Ziel der Schulungen war angeblich „die Sicherheit in den libyschen Küstengewässern zu erhöhen und auf See Leben zu retten“, behauptete die EU. Die Küstenwächter würden „besser in der Lage sein, die Schleusung und den Menschenhandel in Libyen zu unterbinden, Such- und Rettungsaktionen durchzuführen“. Operation Sophie wurde Ende März 2020 eingestellt. Am 31. März 2020 wurde die Operation IRINI eingeleitet, um das UN-Waffenembargo gegen Libyen durchzusetzen. Heute zählt der „Kapazitätsaufbau“ und die Schulung der libyschen Küstenwache zu ihren Aufgaben.[46]
Seitdem die Küstenwache mit ihren Aktionen begonnen hat, sind über 80.000 Menschen auf dem Mittelmeer eingefangen und zurück nach Libyen gebracht worden. Diese verteilen sich auf die bisherigen Operationsjahre wie folgt:
Jahr Anzahl aufgegriffener Migrant*innen
2021 - - (bis 05. November) 27.551
Gesamt 93.296
Evakuierungsprogramme
Die Zustände in den Lagern, in die die Menschen zurück gebracht werden, sind bekannt: Dort herrschen Folter, Erpressung, Vergewaltigung, Sklavenhandel. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International werfen der EU seit Jahren vor, maßgeblich mitverantwortlich dafür zu sein, dass Menschen dort festgehalten werden: „Neue Beweise für erschütternde Übergriffe, einschließlich sexueller Gewalt, gegen Männer, Frauen und Kinder, die bei der Überquerung des Mittelmeers abgefangen und zwangsweise in libysche Auffanglager zurückgeschickt wurden, machen die schrecklichen Folgen der anhaltenden Zusammenarbeit Europas mit Libyen bei der Migration und Grenzkontrolle deutlich,“ heißt es etwa in einem Amnesty-Bericht vom Juli 2021.
Es ist einer der wohl schwerwiegendsten Vorwürfe, die der EU heute gemacht werden: dass das Martyrium Tausender Menschen in den libyschen Lagern Baustein ihrer Migrationsabwehr ist. Die EU versucht diesen Vorwurf mit mit zwei Projekten zu entkräften. Zu sehen war dies etwa im März 2019 als die EU-Kommission dazu ein kleines Video veröffentlichte. Damit wollte sie zwei, wie es darin heißt, „Mythen“ entkräften. Der erste: dass sie „Migranten nach Libyen zurückschickt“. In Wahrheit, so das Video, praktiziere die EU „keine Zurückweisungen nach Libyen“. Der Clip verschweigt, dass die seit 2017 Libyen dafür bezahlt, dass die eigene Küstenwache die Menschen aufhält – und danach werden sie wieder in die Lager eingesperrt.
Auch dass die EU die Bedingungen dort „stillschweigend dulde“, sei ein „Mythos“, heißt es in dem Video. Stattdessen arbeite sie „unermüdlich“ daran „Migranten aus Libyen zu evakuieren und aus der Haft zu befreien“.
Gemeint ist, dass die EU den UN-Organisationen IOM und UNHCR Geld dafür gibt, zu versuchen, einen Teil der Gefangenen wieder aus der Gefangenschaft herauszuholen. Doch sie aus den Lagern zu befreien ist wesentlich schwieriger, als dafür zu sorgen, dass sie hineinkommen.
Voluntary Assisted Return (IOM)
Die Insassen der Internierungslager werden dabei in zwei Kategorien aufgeteilt: Menschen mit potentieller Flüchtlingseigenschaft und Migrant*innen. Bei letzteren wird angenommen, dass eine Rückkehr in ihr Herkunftsland möglich ist, weil sie aus halbwegs sicheren, friedlichen Ländern stammen – etwa Senegal oder Togo. Für diese Gruppe unterhält die UN-Migrationsorganisation IOM das Voluntary Humanitarian Return Programme.
Über 50.000 Migrant*innen hat die IOM von 2017 bis Februar 2020 auf EU-Kosten aus Libyen in über 44 Herkunftsländer ausgeflogen. Für die Flüge chartert die IOM Flugzeuge und begleitet die Migrant*innen. Sie werden von IOM-Mitarbeiter*innen in ihren Rückkehrländern empfangen und erhalten dort medizinische Untersuchungen und Unterstützung, einschließlich Transportbeihilfen und vorübergehender Unterbringung. Die Rückkehrer*innen haben auch Anspruch auf 1.500 Euro Wiedereingliederungshilfe, um sich wirtschaftlich zu etablieren. Das ist in der Regel erheblich weniger als die Menschen für die Reise nach Libyen ausgegeben haben, weswegen sie häufig überschuldet sind und nicht in ihre Dörfer zurück können.
Die EU fördert das Programm mit Mitteln aus dem → EUTF. Das Programm sei „Teil der umfassenderen Gemeinsamen Initiative der EU und der IOM für den Schutz und die Wiedereingliederung von Migranten“ und Element einer „verantwortungsvollen Steuerung der Migration“, behauptet die EU-Kommission.
Emergency Transit Mechanism (UNHCR), ausführlicher unter Niger
Insassen der libyschen Internierungslager, die nicht aus halbwegs sicheren Ländern stammen, können nicht in ihre Herkunftsländer zurück geflogen werden. Sie sind potentiell als Flüchtlinge einzustufen. Das wird angenommen bei Staatsangehörigen etwa aus Eritrea, Sudan, Palästina, Äthiopien, Irak oder Afghanistan. Für sie ist der UNHCR zuständig. Der unterhält in Libyen das ebenfalls von der EU geförderte Programm Emergency Transit Mechanism, kurz ETM: Evakuierungsflüge für gefangene Flüchtlinge aus Libyen, die an sichere Orte gebracht werden müssen. Doch solche sicheren Orte sind rar. Es gibt nicht genug Länder, die sie aufnehmen wollen.
Das Zauberwort heißt „besondere Schutzbedürftigkeit“. Es gibt Kriterien dafür. Vor allem Folteropfer, Schwangere, Mädchen, Frauen, Minderjährige oder Kranke fallen darunter. Auf dieser Grundlage erstellt der UNHCR die Listen für die Evakuierung. Aber auch für jene, die besonderen Schutz brauchen, gibt es nicht genügend Plätze. Und deshalb bleiben viele dort.
In der Anfangsphase des Projekts sind einige Hundert Menschen über das ETM direkt in die EU geflogen worden. 2019 hat sich auch Ruanda bereit erklärt, einige Hundert Flüchtlinge aus Libyen über das ETM-Projekt aufzunehmen. Die meisten der Evakuierten wurden jedoch nach Niger gebracht.
Während in der Vergangenheit Evakuierte entweder direkt aus Haftanstalten oder über die Gathering & Departure Facility (GDF) des UNHCR evakuiert wurden, werden derzeit vor allem Personen aus städtischen Gebieten ausgewählt, die bereits in einer Haftanstalt waren, bevor sie entlassen wurden.
Der erste Evakuierungsflug fand am 11. November 2017 statt. Bis Mai 2021 sind 28 weitere Evakuierungsflüge von Libyen nach Niger mit insgesamt 3.361 Flüchtlingen und Asylsuchenden an Bord angekommen. Sobald die Flüchtlinge und Asylsuchenden in Niger ankommen, führt der UNHCR ein Verifikationsgespräch durch und registriert sie biometrisch. Danach folgt das Verfahren zur Bestimmung des Flüchtlingsstatus (RSD) durch die nigrische Regierung und den UNHCR. Schließlich führt der UNHCR Interviews zur Vorbereitung der Neuansiedlungsakten durch. Diese Dossiers werden dann den Drittländern zur Prüfung vorgelegt.
Die Menschen werden in der Regel in der ETM-Transiteinrichtung in der Gemeinde Hamdallaye in der Region Tillaberi (40 km von Niamey entfernt) untergebracht. Für besonders schutzbedürftige Personen, wie Personen mit medizinischem Betreuungsbedarf, Personen im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium oder Mütter mit Neugeborenen, bleiben fünf Gästehäuser in der Stadt Niamey in Betrieb.
European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM)
Die EU Integrated Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) ist eine zivile Mission zur Unterstützung der Sicherung der libyschen Land-, See- und Luftgrenzen. Sie wurde am 22. Mai 2013 im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) von der Europäischen Union beschlossen. Das zuletzt am 18. Juni 2021 aufgrund des Beschlusses des Rates der Europäischen Union bis zum 30. Juni 2023 verlängerte Mandat umfasst insbesondere die Unterstützung der libyschen Behörden im Bereich des Grenzschutzes und der Inneren Sicherheit. Für 2021 bis 2023 kann die Mission rund 85 Millionen Euro ausgeben. Dies geschieht durch Aus- und Fortbildung der libyschen Polizei, des Grenzschutzes und des Zolls sowie durch die Entwicklung eines sogenannten Integrated Border Management (IBM), einer integrierten Grenzschutzverwaltung. Die Zusammenarbeit findet auf operativer und strategischer Ebene statt. Ein exekutives Mandat besteht nicht. Bis zur Verbesserung der Sicherheitslage in Libyen befindet sich das Hauptquartier in Tunis, Tunesien. Dies ist auch Grund für die verringerte Stärke der Mission, die derzeit 17 internationale Beamt*innen umfasst. Seit dem 1. Februar 2021 leitet die italienische Beamtin Natalina Cea EUBAM Libya. Der größte Auftrag den EUBAM Libya bisher vergab, ging an die französische GEOS SAS Consulting und Risikomanagementfirma. Für 21 Millionen Euro soll sie „Sicherheitsdienste“ in Tripoli übernehmen. Im April 2021 wurde eine „Technische Koordinierungsgruppe“ eingerichtet, die u.a. die Anfragen der libyschen Seite für technische Hilfe beim Grenzschutzaufbau direkt an die zuständigen EU-Stellen weiterleiten soll.
Niger
Kein Land hat der EU in Sachen Migrationsmanagement in den letzten Jahren wertvollere Dienste geleistet als Niger. 2016 hat die EU begonnen, stärker gegen die Migration aus Westafrika vorzugehen. Damals zählte die UN-Migrationsagentur IOM 298.000 Menschen, die über Niger nach Libyen kamen – die meisten wohl mit dem Ziel Europa. 2019 waren es nur noch 50.000. Polizei und Militär haben die Hauptroute durch die Wüste, von der Grenzstadt Agadez nach Libyen gekappt.
Ein wichtiger Faktor dabei war ein neues Gesetz in Niger, das den bis dahin legalen Transport von Menschen in Richtung Libyen als „Menschenschmuggel“ einstuft und bestraft. Die Zahl der Ankünfte von Westafrikaner*innen in Italien ging in der Folge um über 90 % zurück.
Weil die Fahrer der Migrant*innen heute als Kriminelle verfolgt werden, ist der Weg durch die Wüste nur noch auf verschlungenen Wegen möglich. Immer wieder kommt es zu Vorfällen wie Anfang September 2020: Da rettete ein Team der IOM 83 Menschen tief in der Sahara. Die Gruppe hatte eine Woche zuvor in der Transitstadt Agadez vier Pick-up-Trucks bestiegen. Sie fuhren auf abgelegenen Routen nach Libyen, um nicht entdeckt zu werden. Als Militärfahrzeuge in Sicht kamen, setzten die vier Fahrer ihre Passagiere aus. Das komme „häufig vor“, schreibt die IOM.
„Wir gehen davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer sterben als im Mittelmeer selbst“, sagte 2019 der Sondergesandte des UNHCR für das Mittelmeer und Libyen, Vincent Cochetel. Die Zahl der Todesopfer könne aber „auch viel höher sein“. Gerade die Maßnahmen zur Migrationskontrolle, die auf Wunsch der europäischen Staaten eingeführt wurden, hätten das Todesrisiko für Reisende auf Trans-Sahara-Routen erhöht, sagt die Initiative Alarm Phone Sahara, die in Not geratene Migrant*innen in der Wüste unterstützt. Niger wurde dafür in den vergangenen Jahren von der EU mit weit mehr als einer Milliarde Euro schweren Budgethilfen und Entwicklungsprojekten bedacht. Das ist deutlich mehr als die Entwicklungshilfe für vergleichbare Staaten.
EUCAP Sahel
Die EU Capacity Building Mission in Niger (EUCAP Sahel Niger) ist eine zivile Mission der EU zur Beratung und Ausbildung der nigrischen Polizei, Nationalgarde und Gendarmerie. Sie wurde am 8. August 2012 im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der Europäischen Union gestartet. Sie soll die nigrischen Behörden zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und des Terrorismus ertüchtigen. Dabei stehen insbesondere auch solche Gruppen im Visier, denen Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt vorgeworfen wird – wozu eigens neue Straftatbestände (→ „Loi 2015/36“ (im Niger-Report)) geschaffen wurde. EUCAP Sahel führt Aus- und Fortbildung sowie beratende Tätigkeiten durch. Die Mission unterstützt die nigrischen Behörden auch beim Aufbau eigener technischer Kapazitäten und der regionalen und internationalen Kooperation. Das Hauptquartier befindet sich in der Hauptstadt Niamey. 2016 wurde in der weiter nördlich gelegenen Stadt Agadez ein Büro eröffnet. Zuletzt wurde das Mandat bis Januar 2023 verlängert. Die Mission hat für die Zeit von Januar 2021 bis Januar 2023 ein Budget von 89 Millionen Euro. Sie arbeitet mit den benachbarten EU-Missionen EUCAP Sahel Mali und EUBAM Libyen zusammen. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist der Aufbau der Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (siehe nächsten Abschnitt).
Eine der Grundlagen für die Arbeit der Mission ist die Behauptung, dass Terrororganisationen wie der Boko Haram und andere dschihadistische Gruppen, die Organisierter Kriminalität und „Menschenhandel“ verknüpft sind. Die Mission umfasst derzeit etwa 120 internationale Expert*innen und einige Dutzend lokale Bedienstete. Seit Januar 2021 leitet die deutsche Bundespolizistin Antje Pittelkau die Mission. Sie war zuvor von 2018 bis 2020 stellvertretende Missionsleiterin.
Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF)
Niger, eins der ärmsten Länder der Welt, hat eine Nationalpolizei, eine Gendarmerie, eine Nationalgarde und eine Armee. Alle sind auch mit Grenzschutz befasst und seit 2016 mit dem Kampf gegen Schlepper. Trotzdem kündigten Deutschland und die Niederlande 2018 an, eine weitere Grenzschutztruppe aufzubauen: Die Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières. Sie besteht derzeit aus 245 Männern und sieben Frauen. Deutschland und die Niederlande haben dafür einen zweistelligen Millionenbetrag gegeben, Polizist*innen aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden haben sie ausgebildet. Ihr Hauptquartier in der Kleinstadt Birnin Konni an der Grenze zu Nigeria hätte im Oktober 2020 eingeweiht werden sollen. Die Feier wurde allerdings auf Januar vertagt – die Sicherheitslage war zu schlecht.
Deutschland hat Polizist*innen in das Land entsandt. „Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit war die Planung eines zu großen Teilen von Deutschland finanzierten Projekts zum Aufbau mobiler Grenzkontrollkompanien“, teilte die Bundesregierung im Juni 2020 mit.
„Unsere Partner sind die EU und vor allem Deutschland und die Niederlande“, sagte der Kommandant Haro Ammani im März 2020. Es sei schon viel geliefert worden. „Es wird ein modernes Gebäude für die Kompanie errichtet, mit einer modernen Küche, Kommunikationsausrüstung, aber auch viel persönliche Ausrüstung, Schuhwerk, Rettungsausrüstung für Kampfeinsätze, Ambulanzen.“
Die Grenzen in den Wüsten Westafrikas sind bis heute meist unmarkiert. In der Vergangenheit konnte die lokale Bevölkerung sie überqueren, ohne Pässe vorzeigen zu müssen. Das soll anders werden. „Unsere Truppe besteht aus mobilen Einheiten, denn viele Phänomene entziehen sich der Kontrolle der Polizeistationen an den offiziellen Grenzübergängen“, sagt der Kommandant. „Unsere Patrouillen sollen die Menschenhändler und Schmuggler auch jenseits davon verfolgen und festnehmen.“
Formal ist die CMCF für ganz Niger zuständig. Doch dass ihr Hauptquartier an der Grenze zu Nigeria liegt, kommt nicht von ungefähr. Etwa 20.000 Nigerianer*innen stellen pro Jahr in Europa einen Asylantrag – mehr als aus jedem anderen afrikanischen Land.
2050 wird Nigeria bevölkerungsmäßig das drittgrößte Land der Erde sein. Die EU rechnet damit, dass sich von dort immer Menschen auf den Weg nach Europa machen. Nigeria war der erste Staat in Afrika, mit dem die EU-Grenzschutz-Agentur Frontex ein Abkommen zur Zusammenarbeit schloss.
Und gleichzeitig ist Nigers Grenze zu Nigeria auch eines der Einfallstore für islamistische Kämpfer. In den letzten zwölf Monaten stieg der Zahl der Nigrer, die innerhalb ihres eigenen Landes vor dem Terror fliehen mussten, um über ein Drittel auf nun fast 270.000 Menschen. Gegen den Terror setzen Staaten wie Mali und unter anderem auf die Unterstützung der EU. Die hilft, Militär und Polizei schlagkräftiger zu machen. Und die kämpfen dann später gegen Islamisten – und Schlepper.
„Wir sind auch ein Instrument gegen den Terrorismus“, sagt Ammani. Die Betonung liegt auf „auch“. Ammanis Einheit zeigt, wie sehr sich Sicherheits-, Migrations- und Entwicklungspolitik heute im Sahel vermischen. „Die Hauptaufgabe unserer Truppe ist die Sicherung der Grenzen“, sagt Ammani. „Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil.“
„Diese Border Units passen ziemlich gut in das Schema, wie sich das Grenzmanagement entwickelt hat“, sagt zum Aufbau der CMCF die Juristin Carolyn Moser vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Völkerrecht. „Die sollen sich mit irregulärer Migration beschäftigen und dazu beitragen, dass Terroristen nicht über die Grenzen kommen.“
Moser hat mit ihrem Projekt Borderlines erforscht, wie die EU in den Sahel-Staaten Sicherheitsbehörden aufbaut. Der Kampf gegen Migration, Kriminalität und Terror sei unter dem „Prisma Sicherheit“ zusammengefasst worden, sagt sie. Das biete „andere Eingriffsmöglichkeiten“.
Emergency Transit Mechanism (UNHCR), siehe auch Libyen
Insassen der libyschen Internierungslager, die nicht aus halbwegs sicheren Ländern stammen, können nicht in ihre Herkunftsländer zurück geflogen werden. Sie sind potentiell als Flüchtlinge einzustufen. Das wird angenommen bei Staatsangehörigen etwa aus Eritrea, Sudan, Palästina, Äthiopien, Irak oder Afghanistan. Für sie ist der UNHCR zuständig. Der unterhält in Libyen das ebenfalls von der EU geförderte Programm Emergency Transit Mechanism, kurz ETM: Evakuierungsflüge für gefangene Flüchtlinge aus Libyen, die an sichere Orte gebracht werden müssen. Doch solche sicheren Orte sind rar. Es gibt nicht genug Länder, die sie aufnehmen wollen. Deshalb konnte der UNHCR von Ende 2017 bis 2021 nur etwa 4.700 von etwa 57.000 in Libyen registrierten Flüchtlingen evakuieren. Priorität haben jene in den Lagern.
Das Zauberwort heißt „besondere Schutzbedürftigkeit“. Es gibt Kriterien dafür. Vor allem Folteropfer, Schwangere, Mädchen, Frauen, Minderjährige oder Kranke fallen darunter. Auf dieser Grundlage erstellt der UNHCR die Listen für die Evakuierung. Aber auch für jene, die besonderen Schutz brauchen, gibt es nicht genügend Plätze. Deshalb wird ein Teil der Evakuierten erst einmal nach Niger gebracht.
Der erste Evakuierungsflug fand am 11. November 2017 statt. Bis Mai 2020 sind 28 weitere Evakuierungsflüge von Tripolis nach Niamey mit insgesamt 3.361 Flüchtlingen und Asylsuchenden an Bord angekommen. Sobald die Flüchtlinge und Asylsuchenden in Niger ankommen, führt UNHCR ein Verifikationsgespräch durch und registriert sie biometrisch. Danach folgt das Verfahren zur Bestimmung des Flüchtlingsstatus (RSD) durch die nigrische Regierung und den UNHCR. Schließlich führt der UNHCR Interviews zur Vorbereitung der Neuansiedlungsakten durch. Diese Dossiers werden dann den Drittländern zur Prüfung vorgelegt.
Die Menschen werden in der Regel in der ETM-Transiteinrichtung in der Gemeinde Hamdallaye in der Region Tillaberi (40 km von Niamey entfernt) untergebracht. Für besonders schutzbedürftige Personen, wie Personen mit medizinischem Betreuungsbedarf, Personen im fortgeschrittenen Schwangerschaftsstadium oder Mütter mit Neugeborenen, bleiben fünf Gästehäuser in der Stadt Niamey in Betrieb.
Die Nationalgarde bewacht – gegen Bezahlung – das Camp in Hamdallaye. Von der Grenzpolizei müssen sich dessen Insassen alle sechs Monate neue Visa ausstellen lassen, der UNHCR zahlt. Der nigrische Nachrichtendienst DRG eruiert in einer „enquête de moralité“, ob es sich bei Flüchtlingen etwa um Trinker handelt, auch dafür zahlt der UNHCR.
Eine nationale Asylkommission wurde aufgestockt, um für die Evakuierten ein nigrisches Asylverfahren durchzuführen, obwohl die Menschen eigentlich in die EU ausreisen sollen. Für die aus nicht weniger als 14 Ministerien zusammengestellten Mitglieder der Asylkommission lohnt sich die Sache: Ihre Aufwandsentschädigungen wurden auf umgerechnet etwa 80 Euro pro Tag fast verdoppelt.
Für die Evakuierten ist das Projekt ohne Zweifel ein Segen. Und dass Niger, das genug eigene Probleme hat, sich mittelbar von Europa für die Sache bezahlen lässt, ist völlig legitim. Doch gleichzeitig dient das Projekt der EU dazu, ihre eigene unselige Rolle zu verschleiern: Schließlich bezahlt sie Libyen dafür, die Menschen überhaupt erst in die Lager zu bringen, aus denen der UNHCR sie dann befreit.
Sudan
Die Hauptstadt Sudans, Khartoum, war nicht von ungefähr Namensgeber des → Khartoum-Prozesses. Das Land hat für die Horn von Afrika-Region eine ähnliche strategische Bedeutung wie Niger für Westafrika: Alle müssen hier durch. Im Horn von Afrika leben heute rund 11,5 Millionen Geflüchtete und Binnenvertriebene. Das ist etwa jeder siebte Geflüchtete auf der Welt und ihre Zahl in der Region wächst ständig. Allerdings war Sudan bis zum Sturz des Diktators und Kriegsverbrechers Umar al-Baschir 2019 kein einfacher Partner für die europäische Migrationskontrolle. Schließlich wurde der Staatschef vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gesucht. Dennoch baute die EU ab 2016 ihre Zusammenarbeit mit Sudan langsam aus.
Zunächst unterzeichnete die italienische Polizei mit dem Sudan im August 2016 eine bilaterale Absichtserklärung. Darin ging es unter anderem um Kooperation der Sicherheitskräfte bei Grenzkontrollen, Kampf gegen Drogenhandel, Terrorismus und Migration sowie eine bessere Zusammenarbeit bei Rückführungen. Im Auftrag der italienischen Entwicklungsagentur trainiert seitdem die IOM sudanesische Polizisten im „Grenzmanagement“.
Die EU zog bald nach mit dem „Better Migration Management“ (BMM). Wie Naemi Gerloff im Movements Journal nachgezeichnet hat, ist das übergeordnete Ziel des BMM-Projekts, die „Verbesserung der Migrationssteuerung in der Region und insbesondere Bekämpfung des Menschenhandels und der Schleusung von Migranten innerhalb des Horns von Afrika und aus diesem Gebiet.“ Als ein sogenanntes Regionalvorhaben betrachte es die verschiedenen regionalen Transitrouten und umfasst alle Staaten des Khartoum-Prozesses (Sudan, Südsudan, Eritrea, Äthiopien, Dschibuti, Somalia, Kenia, Uganda, plus Ägypten und Tunesien). Das BMM stelle damit eine direkte Fortführung und Ausbuchstabierung des 2014 eingeläuteten Khartoum-Prozesses dar.
Aufgrund ihrer regionalen Präsenz und inhaltlichen Erfahrung wurde die GiZ von der EU und dem BMZ für die Leitung des Vorhabens ausgewählt. Sie führt ein Konsortium von Implementierungsorganisationen, welches die verschiedenen Komponenten des BMM umsetzt: British Council, Civipol, IOM und UNODC, in der abgelaufenen Phase I zusätzlich Expertise France und das italienische Innenministerium. Handlungsfelder sind „Policy-Harmonisierung“, „Kapazitätenbildung“, “Schutzmaßnahmen“ und „Sensibilisierung der Öffentlichkeit“. Politiken des Migrationsmanagements sollen regional angeglichen und der Transfer zum Forum des Khartum-Prozesses gestärkt werden. Dafür werden u.a. Aktionspläne gegen „Schleusung und Menschenhandel“ entworfen, interministerielle Trainings durchgeführt und der Austausch von best practices vorangetrieben. Es finden Untersuchungen zu legislativen Lücken sowie Workshops zum Entwurf neuer Gesetzgebungen statt.
Über die „Kapazitätenbildung“ finden Schulungen für Beamt*innen des Grenzschutzes, der Polizei und Immigrationsbehörde statt. Diese können als überregionale Trainings von Grenzpolizeien aus verschiedenen Staaten stattfinden, sodass auch Beamt*innen geschult werden können, deren Staaten von bilateraler Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland ausgeschlossen sind. Eine „Chance, […] gerade auch mit den Partnern, die wirklich schwierig sind, wie jetzt Sudan oder Eritrea, hier zumindest die Möglichkeit zu haben, sie in ein regionales Konzept einzubinden“, zitiert Gaerloff eine GiZ-Mitarbeiterin. Die Trainings sollen die Grenzbeamt*innen auf den Umgang mit sogenannten „gemischten Migrationsbewegungen“ vorbereiten, menschenrechtliche Standards vermitteln und mit Verfahren zur Statusbestimmung vertraut machen. Ferner ziele der Ausbau von Kapazitäten auf die strafrechtliche Verfolgung sogenannter „Schleuser und Menschenhändler“ ab. Hierzu sollen die wichtigsten Grenzübergänge der Region überprüft, bestehende Grenzposten renoviert und mit Grenzinformationssystemen ausgestattet werden. Auch die Einführung biometrischer Daten wird dabei angestrebt.
Die dritte Komponente, „Schutz“, wirkt auf die Hilfestellung von Betroffenen des Menschenhandels und sogenannter „vulnerabler Personen“ hin. Vorgesehen sind u.a. mappings bestehender Schutzdienstleistungen in den Projektländern, die Entwicklung standardisierter Verfahren zur Bestimmung von „Schutzbedürftigen“ sowie die Einrichtung zweier „Safe Houses“. Auch Programme des „Assisted Voluntary Return and Reintegration“ zählt das BMM zu Schutzdienstleistungen. In Zusammenarbeit mit der IOM soll das Angebot der „Freiwilligen Rückkehr“ regional ausgebaut und bekannter gemacht werden.
Über öffentliche Sensibilisierungsarbeit will das BMM zusätzlich Alternativen zu irregulärer Migration und mögliche lokale Lebensentwürfe aufzeigen, indem zivilgesellschaftliche Organisationen und Aktivitäten (Informationskampagnen, öffentliche Events oder „Community Conversations“) gefördert werden.
Das BMM ist nicht die einzige-europäische Trainingsmaßnahme für Sudans Grenzschützer. An der Polizeischule in Khartoum wird auf Kosten der EU das Regionale Operationszentrum ROCK eingerichtet, in dem die Staaten Ostafrikas ihre Informationen über Schmuggelnetzwerke und Migrationsrouten sammeln und austauschen sollen. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage teilt die Bundesregierung mit: Die Bundespolizei habe im Januar und Februar 2016 Grundlehrgänge in Dokumenten- und Urkundensicherheit mit sudanesischen Grenzpolizisten durchgeführt, die für die Passkontrollen an Flughäfen zuständig sind. Der Schulungsort war jeweils die Trainingsakademie der sudanesischen Polizei in Khartoum.
Nach dem Sturz al-Baschirs 2019 stieg die Zahl der Projekte im Sudan aus dem EUTF an. Insgesamt fließen daraus seit 2016 insgesamt 336 Millionen Euro für 12 Projekte in das Land.
Ein Ergebnis ist, dass der Staat heute Geflüchtete die in Richtung Libyen unterwegs sind von seiner Grenzpolizei stoppt und teils zurückschickt. Der Weg aus Diktaturen wie Eritrea, aus Kriegsgebieten wie Somalia und Äthiopien oder Hunger-Regionen wie Südsudan an sichere Orte in Europa ist damit für Millionen Menschen versperrt.
Marokko
Am 7. Juni 2013 unterzeichneten die marokkanische Regierung und die EU ein Abkommen über eine sogenannte Mobilitätspartnerschaft. Marokko war der erste Mittelmeerstaat, der eine solche Vereinbarung einging; am 3. März 2014 folgte Tunesien. Hauptgegenstand der Vereinbarung waren Visa-Erleichterungen für bestimmte Kategorien von marokkanischen Staatsangehörigen, denen auf der anderen Seite die Selbstverpflichtung zur „Rückübernahme“ aus Europa abgeschobener oder dort unerwünschter Migrant*innen gegenübersteht. Im letzteren Falle geht es nicht nur um die eigenen Staatsbürger*innen, sondern auch um die Angehörigen von Drittstaaten, die nachweislich über Marokko gereist waren. Wie der Menschenrechtsaktivist Ramy Khouili am 27. Oktober 2015 in der Huffington Post feststellte, ist es hinsichtlich der Visa-Erleichterungen bei Absichtserklärungen geblieben, während die Zielsetzungen im Bereich der „Rückübernahme“ aus Europa zurückgewiesener Migrant*innen verpflichtenden Charakter aufweist.
Marokko war lange Zeit ein Land, dessen Staatsbürger*innen auszuwandern versuchten und sich etwa in Frankreich, Belgien, Spanien und in den 1970er Jahren zum Teil auch an Rhein und Ruhr in Westdeutschland niederließen. Heute geht es im Verhältnis zur EU überwiegend nicht um die eigenen Staatsbürger*innen, sondern um Drittstaatenangehörige, die nach Europa einwandern oder über marokkanisches Territorium nach Europa zu kommen versuchen. Denn eine der Außengrenzen der Europäischen Union verläuft durch Marokko – zwei spanische Enklaven liegen auf marokkanischem Boden.
Im Jahr 2006 begann eine verstärkte Einbeziehung Marokkos in das Grenzregime der Europäischen Union. Am 10. und 11. Juli 2006 wurde durch eine Ministerkonferenz in der Hauptstadt Rabat mit dem Titel „Euro-afrikanische Ministerkonferenz zu Migration und Entwicklung“ der sogenannte → Rabat-Prozess gestartet. An ihm nahmen insgesamt gut fünfzig west- und nordafrikanische Staaten sowie Mitgliedstaaten der EU teil. Die beteiligten Staaten halten gemeinsame Konferenzen ab, auf denen über Flucht- und Migrationsursachen debattiert wird. Auf Folgekonferenzen am 25. November 2008 in Paris im Rahmen der damaligen französischen EU-Ratspräsidentschaft sowie am 23. November 2011 in der senegalesischen Hauptstadt Dakar wurde der Versuch unternommen, die Zusammenarbeit zu vertiefen.
Seit 2013 unterstützt die EU die Umsetzung der marokkanischen Nationalen Strategie für Migration und Asyl (Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile). Die EU und Marokko schlossen 2013 ein Mobilitätspartnerschaftsabkommen, das 2019 eine Neuauflage erfuhr. Die Zusammenarbeit erfolgt auch über regionale Dialoge im Rahmen des Rabat-Prozesses und über die Afrikanische Union.
Unter den Nachbarländern verfügt die EU mit Marokko über das zweitgrößte Kooperationsportfolio im Bereich Migration mit einem Gesamtvolumen von 346 Mio. Euro, wovon rund 238 Mio. Euro aus dem Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika und der Rest aus anderen EU-Finanzinstrumenten stammen.
Alle Projekte werden von internationalen Partnern vor Ort durchgeführt, z. B. von UN-Agenturen, EU-Mitgliedstaaten und Organisationen der Zivilgesellschaft.
Eine Besonderheit der marokkanischen Entwicklung liegt darin, dass die Behörden des Landes im Herbst 2013 eine mehr oder minder breit angelegte „Legalisierungspolitik“ für auf dem Boden des Landes lebende Migrant*innen einleiteten. Insgesamt wurden während der rund anderthalbjährigen Dauer dieser Politik rund 14.000 Aufenthaltstitel vergeben. Dies betraf überwiegend subsaharische Afrikaner*innen. Einerseits bedeutete dies eine erhebliche Erleichterung für Menschen, die oftmals seit Jahren in Marokko lebten und dort regelmäßig auch arbeiteten; zum Beispiel, weil sie auf längere Sicht in dem Maghrebstaat festsaßen, obwohl ihr ursprüngliches Reiseziel eher Europa gewesen war. Andererseits verband die EU – die im Allgemeinen einen erheblichen Druck auf Marokko ausübt, um es zur Erreichung eigener migrationspolitischer Vorgaben zu bewegen, diese Politik von Anfang an mit der Zielsetzung, der Ein- oder Weiterreise in Richtung Europa einen Riegel vorzuschieben, indem man „unterwegs“ eine alternative Perspektive anbot. 2015 beendete das marokkanische Regime jedoch die Legalisierungspolitik. Die Praxis, im Norden Marokkos aufgegriffene Migrant*innen – zum Zweck ihrer räumlichen Entfernung von Außengrenzen der EU – in den wüstenhaften Süden des Landes zu verfrachten, wurde wieder aufgenommen. 2016 kündigten die marokkanischen Behörden unterdessen an, es werde eine zweite „Legalisierungsperiode“ geben.
Die EU betont heute, dass die Zahl der Ankünfte nach Spanien über die westliche Mittelmeerroute deutlich zurückgegangen ist. Diese Entwicklung spiegele die „Wirksamkeit“ der Zusammenarbeit zwischen Marokko und Spanien wider.
(mit Material aus dem Länderreport Marokko von Bernard Schmid)
Tunesien
Die Grenzschutz-Projekte der EU werden zum Teil vomThink-Tank → ICMPD umgesetzt. Eins der wichtigsten davon ist das Border Management Programme for the Maghreb (BMP-Maghreb), das mit insgesamt 55 Millionen Euro ausgestattet ist und in Marokko und Tunesien irreguläre Migration bekämpfen und die „Grenzmanagementkapazitäten“ relevanter Behörden stärken will. 20 der 55 Millionen Euro der Projektmittel sind für Tunesien vorgesehen – allein 70 Prozent davon sollen nach Angaben des ICMPD-Büros in Tunis in die Beschaffung von Ausrüstung und Infrastruktur investiert werden. Der tunesische Projektpartner ist das Innenministerium, auf europäischer Seite ist neben dem ICMPD zudem das italienische Innenministerium federführend involviert.
Zusätzlich zum BMP-Maghreb ist das ICMPD mit der Durchführung des aus ENI-Mitteln finanzierten EUROMED Migration IV-Programms. Ziel dieses Projektes ist die Stärkung von Nord-Süd- und Süd-Süd-Dialogen und regionalen Kooperationsmechanismen in migrationspolitischen Fragen. Das Land bekommt knapp 13 Millionen Euro aus dem EUTF für eine Projekt zur „Verbesserten Migrationsverwaltung“ und zur Unterstützung bei der Umsetzung der nationalen Migrationsstrategie Tunesiens. Damit sollen Remittances tunesischer Arbeitsmigrant*innen dazu genutzt werden, Arbeitsplätze im Land zu schaffen. Zudem sollen “Rückkehrer*innen“ (→ Return) bei der Wiedereingliederung unterstützt werden.
Außerdem ist Tunesien am EUROMED Police IV-Projekt beteiligt,[47] in dessen Rahmen unter anderem ein Informationsaustausch mit Europol sowie Internet-Überwachung auf der Agenda stehen. Schließlich ist es Teil des vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) durchgeführten Regionalvorhabens „Dismantling Criminal Networks Operating in North Africa“-Programm. Letztes startete 2020 und baut Abfangkapazitäten von Grenzkontrollbehörden an zentralen Grenzübergängen und in für Schleuser wichtigen Städten aus. Das formell unter dem Label „Kampf gegen Menschenhandel und -schmuggel“ firmierende Projekt will die „regionale Zusammenarbeit stärken“ und Tunesien mittels Trainings in Sachen Verhinderung und Bekämpfung von Cyberkriminalität unterstützen. In Fragen der technischen Hilfe greift UNODC in diesem Programm auf Ausbilder*innen aus Italien, Frankreich und Großbritannien zurück und kooperiert mit Deutschland im Bereich Erkennungskapazitäten gefälschter Dokumente und Urkunden. Berlin lieferte in diesem Kontext entsprechende Ausrüstung und finanzierte Trainings- und Ausbildungsmaßnahmen zugunsten Tunesiens.
(mit Material aus dem Länderreport Tunesien von Sofian Naceur)
Senegal
31.600 Menschen gelangten 2006 aus Westafrika über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln. Spanien schloss daraufhin mit den Regierungen von Mauretanien und Senegal Verträge. Die Guardia Civil durfte kommen und im Senegal Migrant*innen verfolgen, fast so, als sei dies hier ihr eigenes Land. Ab 2009 war die sogenannte Atlantikroute zu. Fast keine Afrikaner*innen kamen mehr von Senegal aus zu den Kanaren durch. Frontex beteiligte sich am Einsatz der Spanier*innen firmiert als Frontex-Operation „Hera“. Im Hafen Dakars liegen seither Schiffe der Guardia Civil, Typ Rodman 101, 31 Meter lang, 1.500 PS, Nachtsichtgeräte, Infrarotkameras, moderne Radarsensoren, je zehn Mann Besatzung, Höchstgeschwindigkeit 64 Stundenkilometer. Jede Nacht fahren sie hinaus, unterstützt von einem Helikopter, den die Spanier*innen auf dem Flughafen von Dakar stationiert haben. Mit den senegalesischen Beamt*innen beobachten sie die Boote, die in Richtung Kanaren fahren, halten sie auf und schicken sie zurück. Offiziell unterstützen die Spanier*innen die Senegales*innen nur. Tatsächlich „entscheiden wir, wohin wir fahren und welche Schiffe kontrolliert werden. Die Senegalesen führen das dann aus“,1 sagt einer der Grenzschützer. Die Arbeit sei „präventiv“, sagt er. „Die sollen wissen, dass wir hier sind, und gar nicht erst losfahren.“
Spanien war das erste Land der EU, in das im letzten Jahrzehnt in größerer Zahl irreguläre Migrant*innen aus Afrika kamen. Und es war das erste, das auf die Idee kam, den Transitstaaten mehr Entwicklungshilfe zu geben, um diese zu blockieren. Mit seinem „Plan África“ ab 2004 vervierfachte Spanien seine Hilfsgelder in Westafrika. „Wir glauben, dass es sinnvoll ist, die Aufstockung der Entwicklungshilfe an die Ausarbeitung von Migrationsabkommen zu koppeln“, sagte der damalige Justizminister Juan Fernando López Aguilar.
Die Überwachung fängt nicht erst auf See an, sondern schon an Land. Dort sucht die Polizei nach Schleppern und Menschen, die die Überfahrt planen. „Die arbeiten mit dem spanischen Geheimdienst zusammen.“
Eine vergleichbare Kooperation, bei dem ein Nicht-EU-Staat europäischen Grenzpolizisten in diesem Maß faktische Hoheitsrechte einräumt, gab es lange es nirgendwo sonst. „Spanien hat diese Grenzkontrollen und Rücknahmen von Ländern in Westafrika verlangt und bekommen“, sagt Louis Vimont, einst Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes EEAS. „Aber es ist dabei sehr geräuschlos vorgegangen, keine öffentlichen Erklärungen, das war das Geheimnis.“ Deswegen sei das Land damals weiter gekommen als die Europäer*innen heute bei ihren Verhandlungen mit anderen afrikanischen Staaten.
Neun Monate im Jahr sind die spanischen Behörden allein in Dakar. Von August bis Oktober – der Zeit, in der mit den meisten Überfahrten gerechnet wird – schickt Frontex Schiffe und Flugzeuge aus anderen EU-Staaten zur Unterstützung. Die Frontex-Präsenz hat dazu geführt, dass Senegales*innen, die nach Europa wollen, zuletzt meist den lebensgefährlichen Weg durch die Sahara, über Libyen und das Mittelmeer gewählt haben.
Afghanistan
Am Rande der Brüsseler Afghanistan-Geberkonferenz 2016 unterzeichneten die EU und Afghanistan ein Abkommen namens „Joint Way Forward.“ Das informelle Abkommen ist ohne Beteiligung des Europäischen Parlaments geschlossen und es war kein transparenter Berichtsmechanismus für seine Umsetzung vorgesehen. Es zielt darauf ab, die Abschiebung von Afghan*innen, die nach Europa gekommen sind, um Schutz zu suchen, nach Afghanistan zu erleichtern. Es wird vermutet, dass die EU die afghanische Regierung mit Hilfe ihrer Entwicklungshilfe zur Unterzeichnung dieses informellen Abkommens gedrängt hat.
Die Kommission selbst verweist darauf, dass das Abkommen „maßgeblich dazu beigetragen hat“, dass afghanische Staatsangehörige, die sich irregulär im Hoheitsgebiet der EU aufhalten, zurückgekehrt sind. Zwischen 2016 und 2019 reisten 18.090 afghanische Staatsangehörige aus der EU nach Afghanistan aus, einschließlich freiwilliger Ausreisen und Abschiebungen. Im selben Zeitraum fanden 81 von der Frontex organisierte Charterflüge mit 2.049 Menschen an Bord statt. Der „Joint Way Forward“ lief vom Oktober 2020 aus. Eine neue „Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit im Bereich der Migration“ wurde am 26. April 2021 unterschrieben.
„Resettlement“
Im Sommer 2015 hatte die Kommission ein erstes EU-Resettlement-Program mit 23.000 Plätzen gestartet. Die 27 Mitgliedsstaaten – außer Ungarn – sagten daraufhin insgesamt 22.504 Plätze für die Umsiedlung von Flüchtlingen in die EU zu. Bis zum Auslaufen 2017 reisten insgesamt 16.049 Personen darüber ein. Ein Großteil davon stammte aus dem „1:1“-Mechanismus des EU-Türkei-Deals, kam also nicht Personen zugute, für die der UNHCR Resettlement-Plätze suchte. Viele Staaten erfüllten ihre Aufnahmezusage nicht. Bulgarien, Kroatien, Zypern, Rumänien, Griechenland, Luxemburg, Malta, Polen, Slowenien und die Slowakei nahmen entgegen ihrer Zusage in 2015 keine einzige Person über das Programm auf.
2017 empfahl die Kommission ein neues Programm mit 50.000 Plätzen. 2017 und 2018 reisten ingesamt rund 49.000 Menschen über EU-Resettlement Programme nach Europa. Auch hier stammte ein Teil aus dem „1:1“-Mechanismus des EU-Türkei-Deals.Die Kommission zahlt rund 10.000 Euro je aufgenommene Person an die Mitgliedsstaaten.
Mittelfristig soll die Praxis der sogenannten Ad-Hoc, also der von Fall zu Fall beschlossenen Resettlement-Programm, durch eine EU-Verordnung zur Harmonisierung von Resettlement abgelöst werden. Darüber verhandelt die EU seit 2016, beschlossen ist bislang (Oktover 2021) noch nichts.
Der Entwurf der Kommission dazu sieht vor, dass die Entscheidung über die Höhe der jährlich aufgenommenen Personen weiterhin bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Durch den Rat soll jedoch eine maximale Anzahl von in der EU aufzunehmenden Personen festgelegt werden. Die Kommission schlug in ihrem Verordnungsentwurf vor, das durch den UNHCR über viele Jahre etablierte Resettlement-Verfahren zu verändern. Dies betrifft insbesondere die Frage, aus welchen Zufluchtsstaaten (Drittstaaten) Personen über Resettlement aufgenommen werden sollen. Anders als bislang sollte nicht allein die globale Periodisierung des UNHCR eine Rolle spielen, sondern zentral auch die Kooperationsbereitschaft der Drittstaaten mit der EU im Bereich von Migration und Asyl – also vor allem die Rücknahme Abzuschiebender.
Zudem sollten nicht nur Menschen in der EU neu angesiedelt werden können, die sich in einem Drittstaat befinden, sondern auch Binnenflüchtlinge, die innerhalb ihres Herkunftslandes vertrieben wurden. Hinsichtlich der Kriterien, die bestimmen, welche Personen für ein Resettlement-Verfahren in Frage kommen, orientiert sich der Verordnungsentwurf überwiegend an den acht Kriterien des UNHCR, ergänzt diese jedoch um das Kriterium der „sozio-ökonomischen Vulnerabilität“, das nicht genauer definiert wird. Zudem sollen auch familiäre Bindungen in den Aufnahmestaat prioritär berücksichtigt werden. Hierunter werden im Vorschlag auch Ehegatten und minderjährige Kinder genannt. Des Weiteren sollen auch soziale und kulturelle Verbindungen in den Aufnahmestaat, die integrationsförderlich seien, als Aufnahmekriterium berücksichtigt werden.
Als Ausschlussgründe für eine Aufnahme nennt der Vorschlag unter anderem die tatsächliche oder versuchte irreguläre Einreise in die EU. Ausgeschlossen von einer Aufnahme sollen zudem Personen sein, die innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren von einem anderen Mitgliedstaat zur Aufnahme abgelehnt wurden. Der Vorschlag der Kommission enthält außerdem ein gewöhnliches Verfahren und ein Eilverfahren. Im gewöhnlichen Verfahren steht den Personen vor der Aufnahme ein Flüchtlingsstatus oder ein subsidiärer Schutzstatus zu. Das Eilverfahren kann im Falle spezifischer dringender humanitärer Anlässe umgesetzt werden und orientiert sich an den bereits beschlossenen Verfahren im Rahmen der EU-Türkei-Erklärung. Beim Eilverfahren sollte bei Aufnahme nur ein subsidiärer Schutzstatus feststehen. Die Flüchtlingseigenschaft sollte dann nach Aufnahme geprüft werden.
Projekte zur Arbeitsmigration
Aufgrund des wachsenden Arbeitskräftemangels in vielen EU-Staaten wie Deutschland oder Polen gibt es eine ganze Reihe nationaler Strategien und Projekte. Polen etwa lässt Hunderttausende Menschen vor allem aus der Ukraine zur Arbeistaufnahme ins Land. Deutschland betreibt eine Reihe so genannter Anwerbeabkommen für „Mangelberufe“ mit Drittstaaten. Unter dem Label „Make it in Germany“ können ausgebildete Fachkräfte besonders gefragter Berufe eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Auch die EU hat sich des Themas angenommen, wenn auch längst nicht mit vergleichbarem Nachdruck wie jenem der Grenzabschottung.
Das wichtigste existierende Projekt ist die Blaue Karte EU. Sie fußt auf der Richtlinie 2009/50/EG und soll insbesondere hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen den Aufenthalt in der EU ermöglichen. Die Gründe für die Einführung dieser Karte waren das zukünftig erwartete Fehlen qualifizierter Personen in einigen Beschäftigungssektoren sowie die unterschiedlichen Modalitäten der Zulassung in den Mitgliedstaaten. Die EU sollte im globalen Wettbewerb um Fachkräfte einheitliche Regeln bekommen. Die nationalen Richtlinien für die Arbeitsmigration blieben unberührt. Die Blaue Karte ist „on top“. Ihren Inhaber*innen soll das gleiche Entgelt wie EU-Büger*innen in vergleichbarer Position gezahlt werden. Ansprüche auf Berufsbildung oder Sozialhilfe gibt es zunächst nicht. Sie müssen erst durch Erwerbstätigkeit erworben werden. Seit Inkrafttreten 2009 kamen nur knapp 37.000 Fachkräfte mittels der Blauen Karte aus Drittstaaten in die EU, davon mehr als drei Viertel nach Deutschland. Zum Vergleich: 2020 stellte allein Polen rund 500.000 Arbeitsvisa für Drittstaatler*innen aus. Die nationalen Zugangswege auf den europäischen Arbeitsmarkt sind also statistisch weitaus bedeutsamer als der EU-Rahmen.
Im September 2021 stimmte das EU-Parlament für eine Reform der Blaue-Karte-Richtlinie. Sie sieht erleichterte Einreiseregeln für hoch qualifizierten Zuwanderer*innen vor. Statt eines Zwölf-Monats-Arbeitsvertrags in einem EU-Land reicht künftig ein Sechs-Monats-Vertrag aus, um den Antrag zu stellen – oder eine entsprechende feste Jobzusage. Auch müssen Anwärter*innen in Zukunft in ihrem Wunschland nicht wie bislang deutlich mehr verdienen als der Landesdurchschnitt. Daneben sollen Familienangehörige von Blaue-Karte-Fachkräften schneller in die EU nachkommen und selbst auch arbeiten dürfen. Nun muss formell noch der Rat zustimmen. Anschließend haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, um die neuen Regeln in nationales Recht zu gießen.
Im Zuge des 2020 vorgestellten New Pact on Migration kündigte die Kommission Sondierungen zum Aufbau eines „EU-Talentpools“ für qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittländern an. Dieser soll als „EU-weite Plattform für die internationale Rekrutierung“ dienen. Über die zu schaffende Plattform könnten qualifizierte Drittstaatsangehörige ihr Interesse an der Aufnahme einer Tätigkeit in der EU bekunden, sodass Migrationsbehörden und Arbeitgeber in der EU dort die benötigten Arbeitskräfte ausfindig machen könnten. Der Vorschlag geht zurück auf ein Papier der OECD von 2019. Bis Ende 2021 war das Projekt in der Beratung. Ende 2021 forderte das EU-Parlament die Kommission auf, das Projekt voran zu treiben und durch multilaterale Anwerbeabkommen mit Drittstaaten zu ergänzen.
Mobility Partnerships
Unter „Mobiltätspartnerschaften“ versteht die EU freiwillige Kooperationsvereinbarungen zu „Migrations- und Mobilitätsfragen von beiderseitigem Interesse“ mit den EU-Nachbarländern. Sie existieren schon seit den Nuller Jahren, fanden als Konzept aber erst Eingang in den „Gesamtansatz für Migration und Mobilität“ (GAMM) der EU im Jahr 2011.
Darin hieß es: „Im Rahmen von Mobilitätspartnerschaften und Gemeinsamen Agenden sollten spezielle Migrations- und Mobilitäts-Ressourcenzentren (Migration and Mobility Resource Centres – MMRC) in den Partnerländern eingerichtet werden. Ausgehend von den Erfahrungen mit der Mobilitätspartnerschaft zwischen der EU und Moldau und dem → CIGEM in Mali sollten diese Zentren bei den entsprechenden nationalen Behörden oder Arbeitsvermittlungsstellen angesiedelt werden. Die Zentren sollten als Anlaufstelle für Personen dienen, die etwa bei der Anerkennung ihrer Qualifikationen, der Vorbereitung der Migration, der Rückkehr und der Wiedereingliederung Hilfe brauchen. Mittelfristig sollten diese Zentren mit den gemeinsamen Visumantragstellen und den EU-Delegationen vernetzt werden, um die „Visumverfahren für bestimmte Gruppen von Drittstaatsangehörigen zu verbessern und zu vereinfachen.“
So weit kam es bisher kaum irgendwo. Doch gleichwohl haben im Laufe der folgenden Jahre vor allem Staaten der so genannten „Östlichen Partnerschaft“ Mobilitätspartnerschaften mit der EU unterzeichnet. Im Kern sehen die Vereinbarungen vor, dass die Staaten Visaerleichterungen bekommen und im Gegenzug Rückübernahmeabkommen zustimmen. Unterzeichnet haben (alle jeweiligen Originaldokumente gesammelt hier):
- Die EU und die Ukraine unterzeichneten ein Abkommen zwischen der EU und der Ukraine zur Erleichterung der Visaerteilung, das im Juni 2007 in Kraft trat. Geänderte Fassung Juli 2013 in Kraft getreten.
- Die EU und die Republik Moldau unterzeichneten im Juni 2008 eine Mobilitätspartnerschaft. Rückübernahmeabkommen trat im Oktober 2007 in Kraft. Geänderte Fassung des Visaerleichterungsabkommens seit Juli 2013
- Die EU und Georgien unterzeichneten 2009 Mobilitätspartnerschaft. Visaerleichterungsabkommen und Rückübernahmeabkommen traten im März 2011 in Kraft.
- Die EU und Armenien unterzeichneten 2011 eine Mobilitätspartnerschaft. Visaerleichterungsabkommen im Dezember 2012, Rückübernahmeabkommen im April 2013 unterzeichnet. Beide Abkommen traten im Januar 2014 in Kraft.
- Die EU und Republik Aserbaidschan unterzeichneten Visaerleichterungsabkommen im November 2013 und Rückübernahmeabkommen im Februar 2014. Beide Abkommen sind im September 2014 in Kraft getreten. Die Mobilitätspartnerschaft wurde im Dezember 2013 unterzeichnet.
- Im Jahr 2014 begannen die EU und die Republik Belarus mit der Aushandlung von Visaerleichterungs- und Rückübernahmeabkommen. Die Mobilitätspartnerschaftwurde im Oktober 2016 unterzeichnet.
Migration Partnership Framework
Nicht zu verwechseln mit den → Mobilitätspartnerschaften sind die Migrationspartnerschaften aus dem sogenannten Migration Partnership Framework der EU, die im Juni 2016 ins Leben gerufen wurden. Sie zielten darauf, mit verstärkter Entwicklungshilfe zunächst fünf afrikanische Staaten zu besonderer Kooperation in der Migrationspolitik zu bewegen.
Offizielle Ziele des MPF waren:
- Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans von Valletta
- Minderung der Ursachen für Flucht und irreguläre Migration
- Förderung bestehender legaler Migrationswege
- Schutz für Migrant*innen und Flüchtlinge
- Verhinderung der irregulären Migration sowie Bekämpfung des Menschenhandels
- Stärkung der Zusammenarbeit bei der Rückkehr, Rückübernahme und Reintegration
„Partnerstaaten“ waren zunächst Äthiopien, Mali, Niger, Nigeria und Senegal. 2017 kamen Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Afghanistan, Bangladesch und Pakistan hinzu.
„Die nichteuropäische Seite hat dem Text des 'Partnerschaftsabkommens' und den darin enthaltenen Bedingungen allerdings nie zugestimmt. Deshalb ist nach Ansicht der Fragestellenden schon die Bezeichnung der nicht transparenten Abkommen als 'Partnerschaften' irreführend“[48], schreibt die Linksfraktion im Bundestag 2021 in der Vorbemerkung zu einer Anfrage an die Bundesregierung.
Das wichtigste Instrument des Migration Partnership Framework war von Anfang an der → EUTF. Das bedeutet auch, dass schon nach kurzer Zeit nicht nur die ursprünglichen Schwerpunktstaaten, sonder Dutzende Herkunfts- und Transitstaaten von dieser Politik betroffen waren.
Von Anfang an wurde gedroht, die Staaten, die nicht kooperieren, sollen bei der Vergabe von EU-Entwicklungsgeldern schlechter wegkommen. Außerdem drohen Handelserschwernisse. Die EU-Kommission sprach zunächst noch etwas verklausuliert von einem „Mix aus positiven und negativen Anreizen“, um „die Anstrengungen der Länder zu honorieren, die bereit sind, bei der Migrationskontrolle wirksam mit der EU zusammenzuarbeiten, und um Konsequenzen für jene sicherzustellen, die dies verweigern.“
Der Europäische Rat spart sich dieses sprachliche Blendwerk und droht unverblümt den renitenten Transit – und Herkunftsstaaten. Im Entwurf heißt es, der Rat fordere „unter Einsatz aller einschlägigen – auch entwicklungs- und handelspolitischen – Maßnahmen, Instrumente und Hilfsmittel der EU, die erforderliche Hebelwirkung zu erzeugen und zu nutzen.“
„Die so vorgenommene Konditionalisierung von Geldern der Entwicklungskooperation und die Vermischung finanzieller Anreize mit migrationspolitischen Interessen widerspricht eklatant den Menschenrechten und den Sustainable Development Goals“[49], so die Linksfraktion im Bundestag 2021 in der Vorbemerkung zu einer Anfrage an die Bundesregierung.
Ein wichtiges Ziel war unter anderem die Steigerung der so genannten „Ausreisequote“ von abgelehnten Asylsuchenden aus den jeweiligen Ländern in der EU zu steigern, und zwar von etwa 10 % in 2016 auf rund ein Drittel innerhalb von zwei Jahren. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Zu Senegal etwa schrieb der → EEAS in seinem 4. Fortschrittsbericht zur MPF im Juni 2017: „2016 war ein erheblicher Anstieg der Zahl der Rückkehrentscheidungen zu verzeichnen (5445 gegenüber 4695 im Jahr 2015), dennoch sank die Rückkehrquote von einem bereits sehr niedrigen Wert (12,5 %) auf 9 %. Die Zahl der Anträge auf Ausstellung von Reisedokumenten durch die Konsulate, die positiv beschieden wurden, ging ebenfalls zurück. Zwar sind senegalesische Beamte zu offiziellen Besuchen in EU-Mitgliedstaaten gereist, die daraus resultierenden Folgemaßnahmen in Bezug auf die Rückkehr von Migranten lassen aber weiterhin zu wünschen übrig, was auf die schleppende Bearbeitung der Fälle durch die senegalesischen Behörden und Verwaltungsprobleme in EU-Mitgliedstaaten zurückzuführen ist.“[50] In anderen „Partnerstaaten“ war es ähnlich und blieb auch in den Folgejahren so.
Gleichwohl ist bislang noch keinem Staat wegen mangelnder Kooperation die Entwicklungszusammenarbeit gekürzt worden. Allerdings findet eine tiefgreifende Umschichtung der europäischen Mittel der Entwicklungszusammenarbeit statt, weshalb kooperierende Staaten immer mehr und andere deshalb schleichend weniger bekommen.
Die Europäische Migrationsagenda und der mit ihr verbundene „Partnerschaftsrahmen“ werden seit September 2020 auf Grundlage des von der EU-Kommission im September 2020 vorgelegten „Migrations- und Asylpakets“ weiterentwickelt.
Welche Rolle spielen (welche) NGOs?
ICMPD
Auf NGO-Ebene ist zur Umsetzung der EU-Migrationspolitik vor allem der Think-Tank ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) zu nennen.
Es handelt sich rechtlich gesehen um eine internationale Organisation, die von Österreich und der Schweiz 1993 gegründet wurde und mittlerweile 18 Mitgliedsstaaten umfasst.
Nach der Gründung im Jahr 1993 kam 1995 Ungarn und 1998 Slowenien hinzu. 2001 wurde die Tschechische Republik Mitglied, 2002 folgten Portugal und Schweden, 2003 Bulgarien und Polen, 2004 Kroatien, 2006 die Slowakei, 2010 Rumänien, 2011 Bosnien und Herzegowina und Serbien und 2012 die Republik Nordmazedonien. Malta und die Türkei traten beide 2018, Deutschland 2020 bei.
Das ICMPD wurde gegründet, um migrationsbezogene politische Empfehlungen an die Regierungsbehörden von Staaten sowie an externe staatliche und zwischenstaatliche Stellen zu geben. Das ICMPD hat Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen. Seit 2016 wird es vom ehemaligen österreichischen Außenminister Michael Spindelegger (ÖVP) geleitet. Es konzentriert es sich in erster Linie auf den europäischen Raum und hat seinen Hauptsitz in Wien. Derzeit hat es 340 Mitarbeiter*innen, eine Mission in Brüssel sowie Vertretungen in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Es arbeitet nach eigenen Angaben mit mehr als 570 Partnern*innen – darunter EU-Institutionen und UN-Behörden – zusammen.
Das ICMPD hatte 2020 ein Projektvolumen von 241 Millionen Euro. Damit führt es pro Jahr ca, 40 Konferenzen und rund 1.400 „Trainings“ durch. Es ist maßgeblich für die Vorbereitung des Rabat-, Khartoum sowie des Valetta-Prozesses und die daraus hervor gegangenen EU-Projekte verantwortlich.
Partner*innen des EUTF
Der milliardenschwere EUTF wird im Wesentlichen durch speziell zertifizierte NGOs umgesetzt, die sich für einzelne Projekte bewerben können. Auf diese Weise wurden – stärker als in der Vergangenheit – Akteur*innen der Zivilgesellschaft in die vielfach humanitär daherkommende externalisierte EU-Grenzschutzpolitik eingebunden. Näheres zu den Hintergründen siehe beim Abschnitt zum EUTF. Zu den Implementierungspartner*innen zählen NGOs wie das Schweizer Rote Kreuz oder der Norwegische Flüchtlingsrat, aber erstaunlicherweise auch solche wie Oxfam, die politisch sehr entschieden die EUTF-Politik kritisieren.
Wirtschaftliche Interessen – Wer profitiert?
Siehe auch unsere Border Business List.
Führend auf dem afrikanischen Kontinent sind europäische Sicherheitsfirmen in einem Bereich, der im Rahmen der Grenzsicherungsprogramme mit ausgebaut wird: dem Markt für biometrische Personalausweise und Reisedokumente, die den raschen Durchgang durch die modernen Grenzposten ermöglichen sollen. Rund ein Drittel der geschätzten 1,2 Milliarden Afrikaner*innen ist laut einer Statistik der Weltbank von 2016 bislang überhaupt nicht staatlich registriert. Es gibt in vielen afrikanischen Ländern kein Meldeverzeichnis, denn die letzte Volkszählung ist Jahrzehnte her, oder die Regierung stellte bislang gar keine Personalausweise aus.
Zentrale Datenspeichersysteme, vernetzte Computer, Server, Fingerabdruckscanner, Digitalkameras, Lesegeräte – die Hightechausrüstung für Grenzposten kostet ein Vermögen. Oft scheitert deren Verwendung schon an der mangelnden Stromversorgung am Schlagbaum in der Wüste. Doch es gibt internationalen Druck, dies zu ändern. Die Internationale zivile Luftfahrtbehörde ICAO (International Civil Aviation Organization), eine UN-Sonderorganisation, hatte eine Frist gesetzt: Seit 2015 dürfen weltweit Reisende nur noch mit maschinenlesbaren Pässen unterwegs sein. Länder wie Marokko, Senegal, Äthiopien, Sudan, Kenia, Uganda oder Liberia haben in den vergangenen Jahren daher biometrische Ausweisdokumente eingeführt. Die sechs Länder umfassende Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC) investiert in ein ePass-Projekt. Auf internationalen Flughäfen in Kairo, Nairobi und Accra in Ghana sind die Scanner bereits im Betrieb.
Afrika ist dabei ein idealer Absatzmarkt: Über eine Milliarde Menschen benötigen dort in Zukunft digital lesbare Personalausweise, Reisepässe oder Führerscheine. Oft vergeben sie die Aufträge an Unternehmen wie die Bundesdruckerei in Berlin: Für Libyens Übergangsregierung werden hier beispielsweise Rohpässe gedruckt. Auch der Sudan hat Interesse abgemeldet.
2010 geriet das deutsche Familienunternehmen Mühlbauer aus der Oberpfalz wegen eines dubiosen Deals in die Schlagzeilen: Die auf dem afrikanischen ID-Markt führende Firma beliefert allein sechs afrikanische Staaten. Ihr Afrika-Standort ist Uganda. Dort traf sich Firmenchef Josef Mühlbauer im Jahr 2010 mitten in der Nacht mit dem ugandischen Präsidenten Museveni, um einen Auftrag über 64 Millionen Euro abzuschließen. Und das, obwohl ugandisches Vergaberecht eine öffentliche Ausschreibung vorsieht. Später geriet Mühlbauer wegen Korruptionsvorwürfen in Verruf, der Auftrag wurde von Ugandas Regierung annulliert. 2016 bekam das deutsche Unternehmen Veridos den Zuschlag für den Druck sämtlicher sicherheitsrelevanter Dokumente und ID-Karten, darunter ugandische Reisepässe, Führerscheine, Personalausweise und Geldscheine.
Von einem ähnlichen Korruptionsfall ist auch in Kamerun mit G&D die Rede, einer der Muttergesellschaften von Veridos. Bereits in Simbabwe war G&D in Skandale verwickelt, als es zur Zeiten der Hyperinflation für den dortigen Diktator Robert Mugabe Geldscheine druckte. Der größte Mühlbauer-Kunde in Afrika ist mittlerweile Algerien, auch dort warten lukrative Aufträge. „Hoch skeptisch“ sei das Land gegenüber einem Rückführungsabkommen mit der Gesamt-EU, heißt es in einem internen Strategiepapier der Europäischen Kommission. Nur ein Viertel der geplanten Abschiebungen von Algeriern im Jahr 2014 seien tatsächlich erfolgt. Um die Kooperationswilligkeit des Staates zu erhöhen, werden finanzielle und technische Unterstützung für die Weiterentwicklung einer „biometrischen Datenbank“ vorgeschlagen.
Seit 2002 hat die EU 56 Projekte mit 316 Millionen Euro für die Erforschung von Grenztechnologie finanziert. Führende Rüstungsunternehmen wie Airbus Defence and Space, Thales aus Frankreich, BAE Systems aus Großbritannien, der italienische Konzern Leonardo-Finmeccanica, das spanische Unternehmen Indra, aber auch das deutsche Fraunhofer-Institut oder gar israelische und türkische Firmen hatten Zugriff auf die EU-Fördertöpfe. Sie rüsteten die EU-Grenzen in Bulgarien und Ungarn mit neuester Technik aus: ein superpräzises Radarsystem von Airbus, das kleinste Objekte noch aus 220 Kilometern aufspüren kann.
Treibende Kraft hinter diesen EU-Investitionen in neue Technologien wie die Grenzsicherung sind einflussreiche Lobbygruppen mit Sitz in Brüssel: Die mächtigste Lobbygruppe ist EOS (European Organisation for Security), geleitet von Ex-Thales-Manager Luigi Rebuffi. Daneben gibt es die ASD (Aerospace and Defence Industries Association of Europe), deren Vorsitzender Mauro Moretti zugleich Chef von Finmeccanica ist, sowie den Think-Tank „Freunde Europas“. Diese einflussreichen Lobbyist*innenen gründeten in den vergangenen Jahren sogenannte Arbeitsgruppen: innerhalb der EOS die „AG Intelligente Grenzen“ unter Leitung der französischen Konzerne Safran und Thales oder die „AG Grenzüberwachung“, angeführt von der italienischen Elektronikfirma Selex. Über Technologiepartnerschaften sind diese mittelbar mit Europas führenden Konzernen verbunden. Zum Beispiel entwickelten Mercedes-Benz und Volkswagen Geländefahrzeuge, die dann für Grenzpatrouillen aufgerüstet werden können. In den vergangenen fünf Jahren investierte Airbus mindestens 7,5 Millionen Euro in Lobbyarbeit, Finmeccanica und Thales jeweils rund eine Million Euro. Das muss sich rentieren. Jetzt braucht die neue Technologie einen Absatzmarkt: am besten über Europas Grenzen hinaus.
Der afrikanische Kontinent mit seinen Abertausenden Kilometern von unsichtbaren Grenzen ist der ideale Markt. Mit der zunehmenden Terrorgefahr folgen viele afrikanische Regierungen dem Beispiel Kenias: Sie wollen Unterstützung beim Kampf gegen den Terror, am liebsten von der EU in Form von Ausrüstung und Ausbildung. Umgekehrt vergeben sie Aufträge an internationale Firmen. Ob auf dem von Airbus gesponserten Grenzmanagement- und Technologie-Gipfel im März 2016 in Ankara, der Grenzsicherheits-Expo in Rom oder dem Welt- Grenz-Kongress in Marokko im März 2017 – unter den Teilnehmer*innen sind immer mehr Afrikaner*innen. Der Chef der Abteilung Migration bei der ECOWAS sowie Vertreter*innen der Migrationsbehörde Nigerias und der Nationalen Identifikationsbehörde Ghanas hatten sich beispielsweise angemeldet.
Gleichzeitig sorgt die EU dafür, dass sich afrikanische Regierungen der Logik der intelligenten Grenzkontrollen anschließen. Sie zwingt sie ihren afrikanischen Partner*innen geradezu auf. „Integriertes Management fördert die Prävention von illegaler Migration und den Kampf gegen jede Art von Schmuggel“, heißt es in einem internen Strategiepapier der EU-Kommission zu den Verhandlungen mit Nigeria. Zu diesem Zwecke können auch Gelder aus dem Nothilfefonds für Afrika verwendet werden, heißt es weiter. EU-Entwicklungsgelder dürfen also für die Aufrüstung afrikanischer Staaten ausgegeben werden. Bereits zuvor hatte die EU den Aufbau einer nigerianischen Migrationspolizei gefördert. An der Elfenbeinküste sind „Sicherheit und Grenzkontrolle“ zentrale Interessen der EU, das geht aus einem weiteren internen Kommissionspapier hervor. Integriertes Grenzmanagement legt die EU auch dem Transitland Mali nahe. Wichtig sei „Unterstützung bei Grenzmanagement und -kontrolle“, Ausrüstung werde regelmäßig von malischer Seite angefragt, schreibt die Kommission an den Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten, der die Sitzungen des Europäischen Rates vorbereitet.
Die Hochrüstung der Grenzen mit Hightechgerät ist teuer, das kann sich kaum ein afrikanischer Staat leisten. Hier greifen dann die EU-Mitgliedstaaten in ihre eigenen Taschen, wenn sie damit heimischen Rüstungskonzernen profitable Aufträge sichern können. So stellten das Bundesverteidigungsministerium und das Auswärtige Amt 2016 zwölf Millionen Euro aus dem Topf „Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung“ zur Verfügung, aus dem auch Sicherheitsprojekte im Irak, Jordanien, Mali und Nigeria finanziert werden. Für 2017 wurden weitere 40 Millionen für Tunesien eingeplant, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Auch die EU steuert 14 Millionen Euro für tunesische Grenzaufrüstung bei. Deutsche Bundespolizisten bilden tunesische Grenzschützer*innen aus, die Bundeswehr schickt Schnellboote und gepanzerte Lastwagen. Für 2017 hatte Deutschland mobile Überwachungssysteme mit Bodenaufklärungssystemen an der tunesisch-libyschen Grenze zugesagt. Fünf Nachtüberwachungssysteme, 25 Wärmebildkameras, 25 optische Sensoren und fünf Radarsysteme hat Airbus für die Ausbildung nach Tunesien geliefert. Bezahlt hat das Gerät die Bundesregierung, aus Steuergeldern. Tunesien bekommt die Hightech-Grenze quasi umsonst.
Bis 2020 sind von der EU mehr als sechs Milliarden Euro für den Schutz der EU-Außengrenzen vorgesehen. Davon stammen 2,8 Milliarden aus dem Fonds für Innere Sicherheit und 1,7 Milliarden aus dem EU-Forschungsprogramm für Grenztechnik. Rund 1,5 Milliarden werden für Frontex und EUROSUR veranschlagt. Darüber hinaus gibt es Finanzspritzen für Drittländer: an Libyen rund 66,5 Millionen Euro, Mauretanien 16 Millionen Euro, den Libanon 14 Millionen Euro und Tunesien 23 Millionen Euro, so eine Studie der niederländischen NGO „Stoppt Waffenhandel“.
Der Forscher Mark Akkermann vom Transnational Institute in Amsterdam hat in seiner Studie „The Business of building walls“ ausgerechnet, dass der Weltmarkt für Grenzschutztechnologie – vom Klingendraht bis zur Hightechdrohne – 2018 ein Volumen von 17,5 Milliarden Dollar hatte. Für die kommenden Jahre sei mit einer Wachstumsrate von mindestens acht Prozent zu rechnen. Allein Frontex könne in den kommenden Jahren 2,2 Milliarden Euro für Material ausgeben.
Die Industrie habe durch ihre Lobbyaktivitäten die starke Ausweitung der öffentlichen Ausgaben für Grenzsicherheit in Europa sowohl angeheizt als auch von ihr profitiert, schreibt Akkermann. Statt dass der Blick sich auf die humanitäre und politische Krise richte, die hinter der Abschottung stehe, würden die „Big Player“, Rüstungskonzerne wie Airbus, Leonardo und Thales, dafür sorgen, dass Politik die Abschottung als Wachstumsmarkt begreife – und sich für noch mehr Abschottung einsetzen.
CIVIPOL
Das französische CIVIPOL ist eine Public-Private-Partnership aus dem Rüstungsbereich, die im Jahr 2001 gegründet wurde. Es handelt sich um eine Aktiengesellschaft (societe anonyme), die zu 40 % dem französischen Staat gehört. Weitere Anteile werden von großen Rüstungsherstellern wie → Thales, → Airbus DS und → Safran gehalten.
Das Unternehmen positioniert sich als Betreiber der technischen Zusammenarbeit des französischen Innenministeriums. Es verkauft keine Ausrüstung, sondern bietet Audits, Projektmanagement, Schulungen und Beratung in Frankreich und im Ausland an. Die Verbindungen des Unternehmens zum französischen Staat sind eng. Präfekt Jounot Yann, ein ehemaliger nationaler Geheimdienstkoordinator, ist seit Juni 2017 Vorsitzender und Geschäftsführer von Civipol. Er ist auch der Präsident der Milipol-Messe. Zuvor wurde Civipol von Pierre de Bousquet de Florian geleitet, der zum Stabschef vom französischen Innenminister Gérald Darmanin ernannt wurde und zuvor als nationaler Geheimdienstkoordinator tätig war. Alexis Kohler, der Stabschef von Emmanuel Macron, saß ebenfalls im Vorstand des Unternehmens.
Civipol ist der Hauptanteilseigner (40 %) der wirtschaftlichen Interessenvereinigung MILIPOL (EIG), die große Sicherheitsmessen in Paris, Singapur und Doha organisiert, an denen regelmäßig Überwachungsunternehmen wie Syneris, Ercom und die NSO-Gruppe teilnehmen.
Im Laufe der Jahre war Civipol an verschiedenen EU-Grenzverwaltungsprojekten beteiligt, unter anderem an der Organisation der Bildung eines Grenzschutzes. Civipol hat für die Europäische Kommission ein einflussreiches Beratungspapier mit dem Titel "Durchführbarkeitsstudie über die Kontrolle der Seegrenzen der Europäischen Union" verfasst, das die Grundlage für die derzeitige Politik der EU im Bereich der Außengrenzen bildet. Im Dezember 2016 war Civipol bereits an der Einrichtung und dem Einsatz von Fingerabdruckdatenbanken in Mali und Senegal beteiligt, bevor es zu vollständigen biometrischen Identitätssystemen überging. Außerdem ist Civipol einer der ausführenden Partner eines Projekts mit der Bezeichnung → Better Migration Management am Horn von Afrika durchgeführt wird.
Wer verliert?
Zu den Verlierer*innen der von der EU betriebenen Migrationspolitik gehören
- allgemein Menschen, die darauf angewiesen sind, in Europa Schutz zu suchen, hierfür aber kaum legale Wege in Anspruch nehmen können.
- Menschen, die darauf angewiesen sind, in Europa Arbeit zu suchen, hierfür aber kaum legale Wege in Anspruch nehmen können.
- Menschen, deren Angehörige in Europa als Flüchtlinge leben,ihre Familien aber nicht nachholen dürfen.
- Menschen, die auf dem Weg nach Europa in Internierungslager gesperrt werden.
- Menschen, die in der EU leben, denen dort aber Rechte vorenthalten werden, etwa das Recht auf uneingeschränkte Gesundheitsversorgung, Arbeit, freie Wohnortwahl (vor allem Geduldete, teils aber auch Menschen im laufenden Asylverfahren sowie Papierlose).
- Angehörigen von Menschen, die sich in der EU aufhalten, die aber hier nicht arbeiten dürfen und deshalb kein Geld an die Familien schicken können.
- Menschen, die im Transit oder an den EU-Außengrenzen Opfer von Gewalt durch Sicherheitskräfte oder Polizei werden[51]
- Menschen, deren Bewegungsfreiheit durch die europäische Migrationspolitik eingeschränkt wird

Welchen Widerstand gibt es?
Im Zentrum des Widerstands stehen natürlich die Migrant*innen selbst, die zum Teil unter schwierigsten Bedingungen nach Europa gekommen sind und hier ihre Bewegungsfreiheit, ihr Bleiberecht und ihre Menschenwürde verteidigen – mit vielfältigen Initiativen der Selbstorganisation und mir zahlreichen Protesten.

Die wichtigste Form des migrantischen Widerstands allerdings ist der alltägliche Widerstand, der ein Überleben trotz all der behördlichen Kontrollen ermöglicht, einschließlich des zähen Widerstands gegen die Bedrohung durch Abschiebungen.
In der gesamten EU gibt es darüber hinaus eine überaus aktive Zivilgesellschaft, die die Themenbereiche Flucht/Asyl, Abschottung, globale Bewegungsfreiheit, Migrant*innenrechte und gerechte Entwicklung aufeinander beziehen und zum Gegenstand politischer Kämpfe und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen machen. Eine vollständige Übersicht ist unmöglich, im Folgenden seien lediglich einige besonders wichtige Akteur*innen vorgestellt.
Eine gute aktuelle Übersicht zu aktuellen Aktionen bietet etwa United Against Racism, ein Zusammenschluss von 560 Organisationen aus 46 europäischen Ländern im größten Anti-Rassismus Netzwerk.
Zwischen praktischem antirassistischem Widerstand und flüchtlingspolitischer Lobbyarbeit sind die Europäischen Flüchtlingsräte angesiedelt. Ihre EU-weite Dachorganisation ist das European Council on Refugees and Exiles (ECRE).
Migreurop ist ein europäisch-afrikanisches Netzwerk von Verbänden, Aktivist*innen und Forscher*innen. Ihr Ziel ist es, die Politik der Segregation von Migrant*innen, insbesondere die Unterbringung in Lager, verschiedene Formen der Abschiebung, die Schließung der Grenzen und die Externalisierung der Migrationskontrollen durch die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten bekannt zu machen und anzuprangern. Auf diese Weise trägt sie zur Verteidigung der Grundrechte von Exilant*innen und zur Förderung der Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit für alle bei.
Schon 2009 begann das antirassistische Netzwerk Welcome2Europe zum Thema EU-Außengrenzen zu arbeiten.W2EU ist ursprünglich ein Projekt antirassistischer Gruppen aus Deutschland, aber vor allem in Griechenland, Italien und Spanien aktiv, etwa bei der Bereitstellung von Informationen für Ankommende durch eigene mehrsprachige Info-Guides für Italien, Spanien und Griechenland. Es existiert bis heute.
Aus dem Kontext vom W2EU enstand 2012 zunächst die Initiative Projekts Boats4People und daraus wiederum ab 2013 die Initiative Watch the Med (etwa: „Augen auf's Mittelmeer“), die die Situation von Bootsflüchtlingen im Mittelmeer verfolgen wollte. Sie wiederum war der Vorläufer des 2014 gegründeten Alarm Phone, das sich für die Seenotrettung von flüchtenden Menschen einsetzt.
Zu wichtigen Akteur*innen in Sachen Migrant*innenrechten zählen heute private Seenotrettungs-NGOs, die ab 2015 gegründet wurden und von Beginn ihrer Arbeit an die praktische Arbeit im Mittelmeer mit politischer Lobbyarbeit für sichere Fluchtrouten verbunden haben.„Die zivile Seenotrettung durch Organisationen wie Sea-Watch rettet Menschenleben, ist aber nur eine kurzfristige Symptombekämpfung angesichts eines grundsätzlichen europäischen Problems – der Abschottung Europas. Mit unserer Aktion setzen wir uns für die Schaffung von legalen und sicheren Fluchtwegen ein“, heißt es dazu etwa bei Sea Watch (DE), der ersten deutschen zivilen Rettungsorganisation im Mittelmeer. Nach deren Gründung 2015 kamen die Seenotrettungs-NGOs Sea Eye (DE), Mission Lifeline (DE), Jugend Rettet (DE), SOS Mediterannee (DE), der Verein Mare Liberum (DE), Civil Fleet, MOAS (MT), Resqship (DE) und Open Arms (ES) hinzu.
Ein wichtiger Akteur nicht nur in Italien, sondern auch bei Vernetzung auf europäischer Arci (Associazione Ricreativa Culturale Italiana), der größte italienische gemeinnützige Verein, der nicht mit der katholischen Kirche verbunden ist. Im Jahr 2016 hat sie 4.796 Kulturzentren und eine Million Mitglieder in allen italienischen Regionen.
Aus dem Umfeld von Welcome2Europe entsprang 2011 auch das Netzwerk Afrique-Europe-Interact (AEI), welches die Themen globale Bewegungsfreiheit und gerechte Entwicklung zu verknüpfen versucht. In dem Netzwerk sind antirassistische und entwicklungspolitische Gruppen aus Deutschland und den Niederlanden mit Aktivist*innen und Gruppen aus Mali, Marokko, Niger, Burkina Faso und Togo ein Bündnis eingegangen. AEI arbeitet seit ca. 2018 mit Nachdruck am Aufbau eines Notrufsystems für Flüchtlinge und Migrant*innen in der Sahara – dem Alarme Phone Sahara.
In hunderten Städten entstanden im Sommer 2018 Gruppen der Seebrücke-Kampagne. Sie forderten lokale Entscheidungsträger*innen dazu auf, Aufnahmekontingente für Geflüchtete anzubieten und übt politischen Druck auf das deutsche Innenministerium aus, die Blockade der kommunale Aufnahmebereitschaft zu beenden. Immer mehr Städte schlossen sich dem „Solidarity Cities“-Netzwerk an.
Das Sterben an den Außengrenzen und die Kriminalisierung der humanitären Hilfe beobachtet seit 2005 das Projekt borderline-europe sowie die Forschungsgesellschaft Flucht und Migration.
Die Gewalt an den Außengrenzen dokumentiert seit 2011 das in München gegründete Projekt Bordermonitoring.eu, seit 2017 das Border Violence Monitoring Network, das aktivistisch vor allem die Gewalt durch Milizen und Grenzpolizeien v.a. auf dem Balkan dokumentiert.
Monitoring und humanitäre Hilfe an der Grenze zwischen Polen und Belarus leisten seit 2021 die Vereine Fundacja Ocalenie, Grupa Granica sowie Medycy Na Granicy.
Zu den wichtigsten Initiaven in Spanien zählt das landesweite Netzwerk Federación SOS Racismo sowie die NGO Caminando Fronteras, die vor allem die Situation in den Enklaven Ceuta und Melilla dokumentiert.
Die administrative Seite der Aufrüstung der EU-Grenzen verfolgt seit vielen Jahren die Gruppe Statewatch aus London, die kontinuierlich entsprechende EU-Dokumente leakt.
Migrationsstatistik
2019 zufolge haben die EU-Mitgliedstaaten etwa 3 Millionen erste Aufenthaltsgenehmigungen (Schengen-Visa) für Drittstaatler*innen ausgestellt, davon 1,2 Millionen (40,5 %) zum Zweck der Arbeitsaufnahme. Weit über die Hälfte dieser Arbeitsvisa (625.000) entfiel allerdings auf ein einziges Land, nämlich Polen. Die Regierung versuchte mit der Visavergabe vor allem an Menschen aus der benachbarten Ukraine den Wegzug der eigenen Bevölkerung nach Westeuropa zu kompensieren.
Die weiteren 1,8 Millionen Schengen-Visa in 2019 wurden ausgestellt für erste Aufenthaltsgenehmigungen, die aus Familiennachzug (810.000, 27,4 %), „sonstige Gründe“ (546.000, 18,5 %) und Studium (400.000, 13,5 %).[52]
Im Jahr 2019 gewährten die EU-Mitgliedstaaten 706.400 Personen die Staatsbürgerschaft.
Das Gros des Migrationsgeschehens entfällt auf Zuwanderung aus bzw. Abwanderung in anderen europäischen Staaten. 2019 kamen 66,4 % aller zugewanderten Personen aus einem anderen europäischen Land, davon 51,1 % aus Staaten der EU und 15,3 % aus sonstigen europäischen Staaten. Auch bei den Fortzügen war Europa die Hauptzielregion. Etwa zwei Drittel aller abwandernden Personen zogen im Jahr 2019 aus Deutschland in ein anderes europäisches Land. Rumänien stellte, wie bereits im Vorjahr, das Hauptherkunftsland von Zugewanderten (14,8 % aller Zuzüge), gefolgt von Polen (8,4 %) und Bulgarien (5,3 %).[53]
Die Zahl der in der EU ankommenden Flüchtlinge ist in den vergangenen Jahren durch die zuvor beschriebenen Maßnahmen immer weiter gesunken. 2020 stellten rund 416.000 Menschen einen ersten Asylantrag. Mit 102.500 Antragsteller*innen entfielen 24,6 % auf Deutschland. Es folgen Spanien (86 400 bzw. 20,7 %), Frankreich (81 800 bzw. 19,6 %) vor Griechenland (37 900 bzw. 9,1 %) und Italien (21 200 bzw. 5,1 %).
Syrien ist seit 2013 das Hauptstaatsangehörigkeitsland von Asylbewerber*innen in der EU. Im Jahr 2020 ging die Zahl der syrischen Erstantragsteller*innen auf 63.500 zurück, während der Anteil der Syrer*innen an den gesamten Erstantragstellern in der EU von 11,9 % auf 15,2 % stieg. Auf Afghan*innen entfielen 10,6 % der Gesamtzahl der erstmaligen Asylbewerber*innen, auf Venezolaner*innen 7,3 %, auf Kolumbianer*innen 7,0 % und auf Iraker*innen und Pakistaner*innen 3,9 % bzw. 3,8 %.
Footnotes
-
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fengrenzen_der_Europ%C3%A4ischen_Union.
↩ -
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_de.
↩ - ↩
-
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs.
↩ - ↩
-
https://www.statista.com/statistics/1070317/eu-gdp-growth-rate/.
↩ - ↩
-
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de&pubId=8369.
↩ - ↩
- ↩
- ↩
-
https://edps.europa.eu/data-protection/european-it-systems/schengen-information-system_de.
↩ -
https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/asylum-applications-since-1990/.
↩ -
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean.
↩ -
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/.
↩ -
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_quarterly_report.
↩ -
https://www.easo.europa.eu/asylum-trends-easo-asylum-report-2021.
↩ - ↩
-
https://www.borderviolence.eu/.
↩ -
https://mare-liberum.org/en/pushback-report/.
↩ -
https://data2.unhcr.org/en/country/lby.
↩ -
https://www.infomigrants.net/en/post/33257/migrants-in-distress-returned-to-libya-on-malta-s-request.
↩ - ↩
-
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europa_und_sie/europa_vorstellung/grundrechtecharta.html.
↩ -
https://taz.de/35-Jahre-Schengen/!5689470/.
↩ -
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599045-2019:TEXT:EN:HTML&.
↩ -
https://frontexinvestigation.eu/2021/08/13/ueberwachung-aus-dem-weltraum/.
↩ -
https://frontexinvestigation.eu/2021/08/13/ueberwachung-aus-dem-weltraum/.
↩ - ↩
-
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001943_DE.html.
↩ - ↩
-
https://taz.de/Spanien-stoppt-Fluechtende-in-Dakar/!5473388/.
↩ - ↩
-
https://www.statewatch.org/media/2590/ep-frontex-scrutiny-group-final-report-14-7-21.pdf.
↩ -
https://www.tagesschau.de/ausland/frontex-eu-grenzen-101.html.
↩ -
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179.
↩ -
https://www.freiwillige-rueckkehr.de/kontext/kalkulierte-entrechtung.
↩ - ↩
-
Bundestags-Drucksache 19/246.
↩ -
https://frontexinvestigation.eu/2021/08/13/ueberwachung-aus-dem-weltraum/.
↩ -
Bundestags-Drucksache 19/433.
↩ -
https://www.operationirini.eu/media_category/assets/.
↩ -
https://www.operationirini.eu/about-us/.
↩ -
https://www.enr.com/articles/41851-turkey-continues-construction-of-wall-along-border-with-syria.
↩ -
EU-Rat, Drucksache 5321/17, MAMA 12 CFSP/PESC 23 RELEX 74 LIBYE 3.
↩ -
https://www.operationirini.eu/about-us/.
↩ -
https://www.emcdda.europa.eu/event/2020/01/closing-conference-euromed-police-iv-project_en.
↩ -
Bundestags-Drucksache 19/28830.
↩ -
Bundestags-Drucksache 19/28830.
↩ -
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0350&from=en.
↩ -
https://www.unhcr.org/protection/operations/5f2129fb4/journey-cares-live-die-abuse-protection-justice-along-routes-east-west.html sowie https://www.borderviolence.eu/.
↩ - ↩
- ↩